Fünf Stunden Kitsch - Jan. 2018
Robert Wilsons Sandmann - Dez. 2017
Von Michelangelo die Zeichnung, von Tizian die Farbe - Nov. 2017
Zur Erinnerung an Jeanne Moreau - August 2017
Zwei Museen wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten - Juli 2017
Diana, Prinzessin der Amazonen, rettet die Welt - Juni 2017
Ghost in the Shell - April 2017
Der doppelte Heinrich - März 2017
Annäherung an ein altes Thema: den Kampf der Geschlechter - Febr. 2017
Ohne Hoffnung auf Verabschiedung einer Resolution zur Abschaffung der Ewigkeit der Zeit - Jan. 2017
Henry Moore in Münster - Dez. 2016
Museumssommer 2016 - Juli 2016
Sammlung Henkel: Abstrakt, farbig, glatt - Juni 2016
Bosch neu gesehen - April 2016
Mit einem Apfel fing alles an - März 2016
Der Sammler Eduard von der Heydt - Febr. 2016
Die Woge - Rousseau und vergessene Maler in Essen – Jan. 2016
Rückblick 2015: Was es sonst noch gab - Dez. 2015
Elisabeth Vigée-Lebrun: Die Hofmalerin der Marie Antoinette - Nov. 2015
Ein unbekanntes Genie und eine erschreckende Botschaft - Okt. 2015
Ein Wasserschloss für siebzehn Kinder - Sept. 2015
150 Jahre Alice im Wunderland - Aug. 2015
Eine Verrücktheit im Nationalpark Hoge Veluwe - Juli 2015
25 Jahre Shakespeare-Festival Neuss – Juni 2015
Enten in Lille und ein Drache in Lens - Juni 2015
Mad Men am laufenden Band - Mai 2015
Der Schatten Michelangelos - April 2015
Freispruch für Medea - Der Täter heißt Euripides - April 2015
Aschenputtel - März 2015
Ubiquitous Jessica Chastain - März 2015
Hellauf begeistert und ziemlich enttäuscht - März 2015
Das nackte Leben in Münster – Febr. 2015
Kino 2015 – Febr. 2015
Marion Ackermann und das Zeitalter der Überforderung – Jan. 2015
Verwegene Farben in Frankfurt – Dez. 2014
Japaner in Essen – Nov. 2014
Kathedralen in Köln – Sept. 2014
Jahrestage 2014: Ein Querschnitt der deutschen Geschichte - Aug. 2014
Reichsmuseum Amsterdam - Juni 2014
Der Liebeszauber - April 2014
Die jungen Mädchen von Balthus – Febr. 2014
Vom Verdrängen des Unerträglichen - Dez. 2013
Venedig im Herbst - Nov. 2013
Der ferne Klang von Schwertern: Quellen des Nibelungenlieds - Okt. 2013
Nov 1938 – Sept. 2013
Rätselhaft und kaum bekannt: François de Nomé - Aug 2013
Die Königin in ihrem Exil - Mai 2013
Ein Engländer lobt Deutschland - April 2013
Happy End bei Sonnenuntergang - Febr. 2013
Versuch über das Labyrinthische - Jan. 2013
Die Lady von Shalott - Dez. 2012
Die Ringe des Saturn - Nov. 2012
Unternehmensberater im Kunstpalast - Okt. 2012
1Q84 - Herr Murakami in einer Welt mit zwei Monden - Aug. 2012
Kastell Manta und andere weiße Flecken in Piemont - Juni 2012
Claude G. – Ein Europäer im 17. Jahrhundert - März 2012
Ana Ozores und ihre berühmten Schwestern – Jan 2012
Die Mühle und das Kreuz - Nov. 2011
Washington überquert den Rhein bei Düsseldorf - Okt. 2011
Alle Jahre wieder. Wer war Shakespeare - Sept 2011
Aug in Aug mit Uta von Naumburg - Aug. 2011
Tolkien und sein Ring - Juni 2011
Caravaggios Trickbetrügerin - April 2011
Die Wanderhure im Mantel der Muttergottes - Okt. 2010
Lemprieres Wörterbuch - Mai 2010
Fünfzig Jahre Blechtrommel - Okt. 2009
Weniger bekannte Londoner Museen - Sept. 2009
Die Armbrust und ein ägyptisches Geschenk - Mai 2008
Der Kuss der Sphinx ... - März 2008
Bonjour Russland - Jan. 2008
Was der Besucher im Museum guckt oder dem Beuys seine Karotte - Nov. 2007
Auch Emotionen haben manchmal Gefühle - Okt. 2007
Patinir in Madrid - Sept. 2007
Das Capriccio als Kunstprinzip - Dez. 2006
Dosso Dossi - der erste Impressionist - Mai 2006
Die Arche des Odysseus - Jan. 2006
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer - Okt. 2005
Die schöne Helena in den Romruinen - Aug. 2005
Mein erster Leserbrief - Juli 2005
Das imaginäre Museum - Mai 2005
Hinweis: Auf das Einfügen von Abbildungen habe ich wegen der Urheberrechtsproblematik verzichtet. In meinen Texten erwähnte Gemälde sind meistens im Internet auffindbar.
Im Rahmen eines Thementages „Ägypten“ zeigte arte im Abendprogramm zwei Spielfilme aus den fünfziger Jahren: zunächst „Land der Pharaonen“, anschließend „Sinuhe der Ägypter“. „Land der Pharaonen“ habe ich damals (1955 oder 1956) im Kino gesehen, hatte aber den Inhalt schon lange vergessen. Lediglich die Schlussszene hatte ich noch lebhaft in Erinnerung. In der Grabkammer der großen Pyramide, in die der Sarkophag des verstorbenen Pharaos gebracht worden war, hatten sich Priester und eine habgierige Prinzessin versammelt. Zum Abschluss der Zeremonie bittet der Hohe Priester die Prinzessin, einen bestimmten Stein zu berühren. Ahnungslos entspricht sie seiner Bitte und setzt damit einen Mechanismus in Gang, der die Grabkammer für immer verschließt. Für sie gibt es kein Entkommen.
Der Film beginnt etwa zwanzig Jahre früher mit der Rückkehr des Pharao Cheops von einem seiner siegreichen Feldzüge, in denen er seinen Feinden Gold und Edelsteine abgepresst hat. Er ist ganz besessen von seinem Gold und will mit ihm begraben werden, um es in seinem nächsten Leben im Jenseits benutzen zu können. Daher beauftragt er einen Baumeister, eine Pyramide mit einer für Grabräuber unzugänglichen Grabkammer zu errichten. Um die Ernährung seinen vielen Arbeiter sicherzustellen, verlangt er von den tributpflichtigen Ländern umfangreiche Getreidelieferungen. Aus Zypern erhält er jedoch kein Getreide, sondern eine Prinzessin als Geisel, die ihn nach der ersten Auspeitschung um den Finger wickelt. Sie bringt ihn dazu, ihr seine Schätze zu zeigen und sie als Zweitfrau zu heiraten. Danach beseitigt sie die erste Frau und deren Sohn und überredet schließlich einen Offizier der Palastwache, den Pharao zu ermorden …
Klingt trivial. Ist es auch. Was eigentlich unverständlich ist, weil der Regisseur Howard Hawks eine Reihe bemerkenswerter Filme gedreht hat, z. B. die spritzige Komödie „Leoparden küsst man nicht“, den Krimi „Tote schlafen fest“ und den Western „Rio Bravo“. Hawks hat den Film in Ägypten gedreht und z. B. für die Eröffnungsszene mit dem Marsch der Soldaten und Gefangenen 9000 Komparsen eingesetzt. Man gewinnt den Eindruck, er habe sich mehr für die Landschaft und die Möglichkeiten des noch jungen CinemaScope-Verfahrens interessiert als für die Handlung. So platt wie die Handlung sind die Dialoge, obwohl William Faulkner am Drehbuch beteiligt war. Auch über die Schauspieler ist wenig Rühmenswertes zu berichten. Jack Hawkins spielte den Pharao und Joan Collins (die später durch den Denver-Clan berühmt wurde) die Prinzessin Nellifer.
„Sinuhe der Ägypter“ (ein Jahr vor dem „Land der Pharaonen“ gedreht) habe ich nicht im Kino gesehen – wahrscheinlich, weil er erst ab sechzehn Jahren freigegeben war. Der Film von Michael Curtiz basiert auf Teilen des damals sehr bekannten Romans des Finnen Mika Waltari und erzählt die Lebensgeschichte des ägyptischen Arztes Sinuhe, der aus ärmlichen Verhältnissen kommend zum Leibarzt des Pharaos Echnaton aufsteigt, sich in die Kurtisane Nefer verliebt, ihr nach und nach seinen ganzen Besitz überlässt und dabei seine Pflichten am Hof vernachlässigt. Wegen einer Verfehlung wird Sinuhe des Landes vewiesen. Erst nach Jahren kehrt er zurück und muss erleben, dass Echnatons Versuch, die alten Götter durch einen Glauben an den Sonnengott Athon zu ersetzen, gescheitert ist und dass die Priester und das Volk die Anhänger des neuen Kultes verfolgen und töten.
Das Drehbuch hat erhebliche Mängel. Der Film findet keinen Rhythmus, verschiedene Handlungsstränge laufen ohne dramatische Verknüpfung nebeneinander her. Nach mehreren kurzen Anfangsszenen spielt die nachfolgende Stunde (der Film hatte eine für die damaligen Verhältnisse ungewöhnliche Länge von 140 Minuten) im Haus der Kurtisane, ohne dass man als Zuschauer nachvollziehen kann, woraus die unwiderstehliche Faszination von Nefer bestanden haben soll.
Von den Darstellern muss man Michael Wilding als totale Fehlbesetzung bezeichnen – als Echnation wirkt dieser Schauspieler unglaubwürdig und fast lächerlich. Betrachtet man die Darstellerliste weiter, fällt auf, dass mehrere Nebenrollen von bekannten Hollywood-Stars gespielt wurden, das Schankmädchen von Jean Simmons, Sinuhes Freund Horemheb von Victor Mature, eine Schwester des Pharaos von Gene Tierney und Sinuhes Begleiter Kaptah von Peter Ustinov. Dass aber die Hauptrolle an den unbekannten englischen Schauspieler Edmund Purdom vergeben worden war. Durch Zufall fand ich heraus, dass eigentlich Marlon Brando den Arzt spielen sollte, dass er aber nach wenigen Drehtagen die Arbeit mit der Begründung hinwarf, ihm gefalle der Regisseur nicht, ihm gefalle die Schauspielerin Bella Darvi nicht und ihm gefalle die Rolle des Arztes nicht.
Bella Darvi, die die Kurtisane spielte, war mir völlig unbekannt. Sie hatte kein glückliches Leben. Geboren 1928 als polnische Jüdin hat sie den Weltkrieg in Frankreich überlebt – obwohl sie mehrere Jahre inhaftiert war. Nach dem Krieg wurde sie von Darryl F. Zanuck, einem der mächtigsten Studio-Bosse Hollywoods, entdeckt. Er brachte sie nach Amerika mit der Absicht, aus ihr einen großen Star zu machen. Nach fünf Filmen kehrte sie nach Frankreich zurück und drehte noch eine Reihe unbedeutender französischer und italienischer Filme. Sie verfiel jedoch wieder ihrer alten Leidenschaft für das Glücksspiel und häufte hohe Spielschulden an. 1971 beging sie Selbstmord.
(Im Jan. 2018)
Auch wer nur selten in die Oper geht, wird „Hoffmanns Erzählungen“ von Jaques Offenbach kennen. Die phantastische Oper steht oft und in unterschiedlichen Versionen auf den Spielplänen, was daran liegt, dass Offenbach sein letztes Werk nur als Klavierauszug hinterlassen hat, der im Lauf der Jahre zahlreiche Bearbeitungen erfuhr.
Der Protagonist der Oper ist – wie der Titel schon sagt – der deutsche Schriftsteller E. T. A. Hoffmann, der seinen Freunden beim Wein den unglücklichen Verlauf mehrerer Liebesabenteuer erzählt. Sein erster Bericht handelt von der mechanischen Puppe Olympia und beruht auf der Erzählung „Der Sandmann“ aus dem Zyklus der Nachstücke, die zweite Erzählung handelt von der Sängerin Antonia aus der Novelle „Rat Krespel“ aus den Serapionsbrüdern und die dritte Erzählung von seiner Begegnung mit der Kurtisane Giulietta in der „Geschichte vom verlorenen Spiegelbild“ aus den Abenteuern der Silvesternacht. Das Interesse, das auch heute noch dem Stück entgegengebracht wird, erklärt sich vielleicht daraus, dass Olympia als ein romantischer Vorläufer der aktuellen Diskussionen, Erwartungen und Befürchtungen bezüglich künstlicher Intelligenz und denkender Roboter betrachtet werden kann.
Jetzt hat der bekannte Regisseur und Theaterautor Robert Wilson in Zusammenarbeit mit der Engländerin Anna Calva aus der Sandmann-Erzählung eine Rock-Oper gemacht und sie am Düsseldorfer Schauspielhaus inszeniert. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Student Nathanael, der unter zwei schrecklichen Kindheitserinnerungen leidet. Zum einen hatte sein Vater regelmäßig abendlichen Besuch von dem unheimlichen Advokaten Coppelius erhalten, und zusammen hatten sie alchemistische Experimente durchgeführt, bis sein Vater nach einer Explosion ums Leben gekommen und Coppelius spurlos verschwunden war. Zum anderen hatte die Mutter häufig vom Sandmann erzählt, er streue den Kindern, die abends nicht einschlafen wollten, Sand in die Augen, bis sie blutig aus ihren Höhlen heraussprängen. Nathanael hatte Coppelius für den Sandmann gehalten und ihm die Schuld am Tod seines Vaters gegeben.
Jahre später hört Nathanael Vorlesungen über Physik bei Professor Spalanzani, von dem gesagt wird, er habe eine Tochter mit Namen Olimpia, die er aus unbekannten Gründen einsperre und nicht unter Menschen lasse. Tatsächlich jedoch ist Olimpia eine mechanische Puppe, ein sprechender, singender und tanzender Automat, den Spalanzani gebaut hat, dem aber noch die Augen fehlen. Die verfertigt der Augenglashändler Coppola. Als Nathanael zum ersten Mal Coppola begegnet, glaubt er in ihm den teuflischen Advokaten Coppelius wiederzuerkennen. Trotzdem lässt er sich von ihm überreden, ein Paar Augengläser zu kaufen, die ihm Olimpia bei einem Fest im Hause Spalanzani als glutäugige Schönheit erscheinen lassen. Er verliebt sich hemmungslos in Olimpia und vergisst darüber seine Verlobte Clara. Einige Tage später jedoch wird er zufälligerweise Zeuge eines Streits zwischen Spalanzani und Coppola und erfährt, dass Olimpia nur eine leblose Puppe ist. Da packt ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen, doch seine Braut Clara pflegt ihn wieder gesund. Aber der Wahnsinn kehrt zurück. Nach einer Besteigung des Rathausturms erblickt er am Fuß des Turms Coppelius, verliert den Verstand und stürzt sich hinab. (In der Oper endet der Olympia-Akt damit, dass Coppola die Puppe aus Wut zertrümmert, weil Spalanzani ihn nicht bezahlt hat.)
Die Düsseldorfer Inszenierung beeindruckt mit kühnen und fantasievollen Bühnenbildern voller Kontraste und Scherenschnitteffekte. Christian Friedel erinnert als krähender Rotschopf an eine Struwwelpeter-Figur und zeigt bei den Songs von Anna Calvi große Stimmgewalt, die Musik erinnert in den Streicherpartien an Michaels Nymans Kompositionen für Filme von Peter Greenaway.
(Im Dezember 2017)

Der Wahlspruch „Von Michelangelo die Zeichnung, von Tizian die Farbe“ wird Jacopo Tintoretto zugeschrieben, der zusammen mit dem dreißig Jahre älteren Tizian und dem zehn Jahre jüngeren Veronese den Höhepunkt der venezianischen Malerei des 16. Jahrhunderts verkörperte – zu einer Zeit, als es mit Venedig politisch und wirtschaftlich schon bergab ging. Von den drei Malern war Tintoretto der einzige „echte“ Venezianer. In Venedig geboren und in Venedig gestorben, hat er sein ganzes Leben in der Stadt zugebracht und fast ausschließlich für Auftraggeber aus der Stadt gearbeitet. Tintoretto hat viel und schnell gemalt. Sein erhaltenes Werk umfasst über 300 Bilder, teilweise in sehr großen Formaten, bei einem Drittel davon sind allerdings die Eigenhändigkeit umstritten und der Anteil der Gehilfen und der Werkstattarbeiten ungeklärt. Charakteristisch für sein Werk sind manieristische Merkmale: starke Hell-Dunkel-Kontraste, ungewöhnliche Perspektiven, Untersicht, fliegende Engel und stürzende Körper zuhauf sowie Menschen mit großen Gesten und in Bewegung. Betrachtet man verschiedene Bilder genauer, kann man außerdem feststellen, dass sich Teile, Figurengruppen und Figuren wiederholen, die von einem Bild auf ein zweites übertragen und dort mit anderen Elementen neu zusammengefügt wurden. Man könnte also sagen, dass Tintoretto die serielle Malerei erfunden hat. (Allerdings kann man Ähnliches auch schon bei Lukas Cranach und Tizian beobachten.)
Seine Themen entnahm er der Bibel und der griechischen Mythologie. Außerdem hat er zahlreiche Porträts verfertigt. Besonders gut lässt sich sein Können an einem Spätwerk studieren, an dem er in den letzten Jahren vor seinem Tod gearbeitet hat: dem „letzten Abendmahl“, das in der von Palladio erbauten Kirche San Giorgio Maggiore hängt.
In Vorwegnahme der anstehenden Feiern und Ausstellungen zu Tintorettos 500stem Geburtstag im kommenden Jahr hat das WRM in Köln eine Ausstellung zusammengestellt, die sich das Frühwerk zum Thema genommen hat und so angekündigt war. Dieser Hinweis auf das Frühwerk ist jedoch inzwischen aus den Prospekten und der Internet-Präsentation getilgt und durch den überflüssigen und unverbindlichen englischen Beisatz „a star was born“ ersetzt worden.
Eröffnet wird die Ausstellung mit zwei ungewöhnliche Bildern, einem „Liebeslabyrinth“ und der „Disputa“. Die Zuschreibung des Liebeslabyrinths ist ganz neu. Noch in der umfassenden Monographie des italienischen Verlegers F. M. Ricci „Labyrinths. The Art oft the Maze“ aus dem Jahr 2015 wird Ludovico Pozzoserrato als Maler genannt (ein Flame, der eigentlich Lodewijk Toeput hieß). Während das Liebeslabyrinth ganz untypisch für Tintoretto erscheint, zeigt die „Disputa“ (Jesus im Tempel unter den Schriftgelehrten) viele Elemente, die für das Lebenswerk von Tintoretto typisch werden sollten: die große Tiefe des dargestellten Raums, in dessen Fluchtpunkt der junge Jesus gestenreich sitzt, das gifte Gelb des Gewandes der großen Figur rechts im Vordergrund, die Untersicht, die merkwürdige Reihung von sechs Köpfen zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten in Gelb, die Seitenansicht Mariens, der Gegenfigur des Schriftgelehrten, die links am Rand bewegungslos steht und den Ausführungen ihres Kindes lauscht. Dieses Bild ist wirklich großartig, das Werk eines Frühvollendeten, vielleicht sogar das beste Gemälde der Kölner Ausstellung.
Beim weiteren Rundgang durch die Ausstellung wird nicht erkennbar, wo die imaginäre Grenze zwischen dem Frühwerk und dem späteren Werk gezogen wurde. Ausgestellt sind beispielsweise die Gemälde „Der Sündenfall“ (aus der Accademia in Venedig) aus dem Jahr 1553, „Der heilige Georg tötet den Drachen“ (aus der National Gallery London) aus dem Jahr 1558 und das „Porträt eines älteren Mannes mit weißem Bart“ (aus dem Kunsthistorischen Museum Wien) aus dem Jahr 1564 (Entstehungszeiten nach Angaben einer italienischen Monographie – in der Kölner Ausstellung werden zum Teil abweichende Entstehungsjahre angegeben).
Auf den schon erwähnten „Sündenfall“ stößt man am Ende des Rundgangs. Er ist eine schöne Komposition, die auch von Rubens hätte gemalt sein können. Eva sitzt diagonal unter einem Baum und reicht Adam den Apfel, in den sie noch nicht gebissen hat. Adam sitzt schräg vor ihr (man sieht ihn nur in Rückenansicht), stützt sich mit dem linken Arm am Boden und hält den rechten Arm abwehrend vor den Mund. Aber wie wir wissen, siegte einen Moment später die Neugier. Auf dem Gemälde hat sich Tintoretto einen kaum bemerkbaren Scherz erlaubt: Unterhalb des Haaransatzes ist Adams Nacken von der Sonne des Paradieses leicht gebräunt – sein breiter Rücken aber ist bleich geblieben.
Wenige Meter entfernt hängt ein Gemälde mit dem Titel „Konzert der Musen“. Hier hat sich Tintoretto einen weiteren Scherz erlaubt. Laut Hesiod hatte Zeus mit Mnemosyne neun Töchter gezeugt, die Musen Klio, Euterpe usw. Tintoretto hat aber zehn Frauen gemalt …
(Nov. 2017)

Ende Juli ist die französische Schauspielerin Jeanne Moreau im Alter von 89 Jahren in Paris gestorben. Von den über 100 Filmen, in denen sie im Lauf ihres Lebens gespielt hat, habe ich vielleicht 20 gesehen. Meine Erinnerungen kreisen dabei um Filme aus den sechziger Jahren, danach habe ich sie aus dem Blickwinkel verloren, und ich könnte abgesehen vom „Schloss in Schweden“ keine Filmtitel aus späteren Jahren benennen.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, habe ich sie zum ersten Mal in Antonionis „La Notte“ gesehen, wobei ich mir heute allerdings hauptsächlich die kühle Schönheit Monica Vittis vergegenwärtigen kann. Mit Jeanne Moreau sind mir vor allem „Tagebuch einer Kammerzofe“, „Die Braut trug schwarz“ „Der Prozess“, und „Viva Maria!“ im Gedächtnis geblieben. Dagegen haben ihre berühmten Filme „Fahrstuhl zum Schafott“, mit dem die Nouvelle Vague begann, sowie „Jules und Jim“ oder „Das Irrlicht“ bei mir so gut wie keine Spuren hinterlassen. (Nur den Klang der klagenden Trompete von Miles Davis habe ich noch im Ohr.)
Insgesamt gesehen jedoch war der Eindruck, den sie auf mich machte, überwältigend, und sie war in den 60er Jahren eindeutig meine Lieblingsschauspielerin. Niemand konnte ihr das Wasser reichen – keine Französin, keine Italienerin und auch kein Hollywood-Star jener Jahre. Mit Elizabeth Taylor z. B. konnte ich nichts anfangen, und Brigitte Bardot fand ich langweilig – mit Ausnahme des Films „Viva Maria!“, der furiosen Spätwesternkomödie, in der sie neben der ironisch frivolen Moreau spielte.
Allgemein galt Jeanne Moreau als Ikone der Nouvelle Vague, als Sphinx, Unnahbare und moderne Femme fatale, deren Wirkung auf ihrem Gesicht, ihrer Stimme und ihrem Gang beruhte. Ihre Gesichtszüge waren beunruhigend, oft schmollend oder missmutig mit leicht schiefem Mund. Der Blick war manchmal leer, manchmal durchtrieben und manchmal nur müde. Dazu kamen die raue, tiefe Stimme und ein ungewöhnlicher Gang, gleichzeitig aufreizend und elegant. Jeanne Moreau zeigte die unterschiedlichen Seite einer Frau, sie war unvergleichlich.
Sie hat mit vielen berühmten Regisseuren gedreht, aber merkwürdigerweise keinen Film mit ihrem Altersgenossen Jacques Rivette (beide wurden 1928 geboren), der anderthalb Jahre vor ihr gestorben ist (im Januar 2016). Rivette gehörte mit Truffaut. Godard und Rohmer zur „Viererbande“ der Nouvelle Vague, hatte aber einen langsamen Arbeitsrhythmus und machte durchschnittlich nur alle zwei Jahre einen Film ohne festes Drehbuch, der dem Zuschauer viel Geduld abforderte, weil er meistens drei Stunden dauerte.
Ich habe nur zwei Filme von ihm gesehen, „Céline und Julie fahren Boot“ und „Die schöne Querulantin“ mit Michel Piccoli, Jane Birkin und Emmanuelle Béart, für den er 1991 den Großen Preis der Jury in Cannes verliehen bekam. In dem Film, der 220 Minuten läuft, geht es um einen Maler, der seit Jahren in einer Schaffenskrise steckt und durch eine junge Frau angeregt wird, noch einmal ein Porträt anzufertigen. Die meiste Zeit des Films sieht man ihn hinter einer Staffelei sitzen, und hört, wie er mit einer Feder über den eingespannten Papierbogen kratzt. Von dem entstehenden Akt sieht man nichts, erst am Ende des Films gönnt der Regisseur dem Publikum einen kurzen Blick auf das Bild. Nach meiner Erinnerung war es kein Meisterwerk.
(August 2017)
Nachtrag: Vier Wochen nach Jeanne Moreau starb die zehn Jahre jüngere Mireille Darc. In den 60er Jahren gehörte sie zu den bekanntesten Darstellerinnen des französischen Kinos. Gesehen habe ich sie in „Weekend“ von Jean-Luc Godard.
In diesem Sommer hatte ich Gelegenheit, zwei sehr unterschiedliche Museen zu besuchen; zum einen während einer Portugal-Reise das Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon und zum anderen das wiedereröffnete Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld mit der Sonderausstellung „Das Abenteuer unserer Sammlung II“.
C. Gulbenkian (1869 bis 1955) war ein aus Armenien stammender Ölhändler, der bis zu seinem Tod eine Sammlung von über 5000 Kunstobjekten (Gemälden, Skulpturen, Teppichen, anderen Textilien und Keramiken) zusammengetragen hatte. Testamentarisch vermachte er seine Sammlung und sein Vermögen dem portugiesischen Staat mit der Maßgabe, ein Museum für seine Sammlung zu errichten. Das Museum wurde in den 60er Jahren in einem kleinen Park nördlich des Stadtzentrums gebaut. Äußerlich macht das Gebäude nicht viel her: Es entspricht dem Stil der Zeit, der Eingang ist unscheinbar, und lange Betonbänder betonen die Horizontale. Man könnte das Ensemble auch für ein Verwaltungsgebäude oder eine Schule halten. Im Innern wird man aber durch eine Sammlung außerordentlicher Qualität entschädigt.
Gegliedert ist die Präsentation in zwei große Blöcke: in orientalische und klassische Altertümer sowie in europäische Malerei von der Spätgotik bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Der erste Teil umspannt ca. 3000 Jahre unserer Geschichte, wobei ein Flachrelief des assyrischen Königs Nimrod aus dem 9. Jahrhundert BC als einer der Höhepunkte angesehen werden kann.
Die Gemäldesammlung beginnt mit zwei Brustbildern, einer Heiligen (vermutlich Katharina) von Roger van der Weyden und dem Porträt einer jungen Frau von Domenico Ghirlandaio. Die heilige Katharina trägt die feinen verinnerlichten Gesichtszüge der Spätgotik und ist ein kleines Fragment aus einer vermutlich großen Altartafel aus dem Frühwerk van der Weydens. Das Fragment ist in Europa kaum bekannt, es wurde beispielsweise in der umfangreichen Monografie von Dirk de Vos aus dem Jahr 1999 nicht aufgeführt.
Das Porträt von Domenico Ghirlandaio zeigt eine junge Frau in Dreiviertelansicht vor schwarzem Hintergrund. Sie trägt ein rotes Mieder, wie es in Florenz am Ende des 15. Jahrhunderts Mode war, und eine farblich passende Korallenkette. Beim Betrachten der Gesichtszüge fällt auf, dass der Maler offenkundig bemüht war, ein realistisches Porträt zu schaffen (während er noch wenige Jahre zuvor ein stilistisch schon überholtes Profilbildnis der Giovanna Tornabuoni gemalt hatte).
Von besonderer Qualität ist auch ein großes Porträt von Rubens aus dem Jahr 1630, das seine zweite Frau Helena Fourment in einem schwarzen Kleid zeigt. Zu dem Zeitpunkt war sie achtzehn Jahre alt, er dagegen vierundundfünfzig. Beim Betrachten des Bildes fallen die technischen Fähigkeiten des Malers besonders auf: bei der Behandlung der Hauttöne und der Stoffe des Kleides. Darüber hinaus wird durch den tiefliegenden Horizont die Größe der Figur verstärkt. Auffallend ist auch der für eine Achtzehnjährige ungewöhnliche skeptische Blick, und in diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass manche Kunsthistoriker die Ansicht vertreten, das Porträt zeige nicht Helena, sondern ihre ältere, schon verstorbene Schwester Susanna. Das Gemälde gehörte früher zur Sammlung der russischen Zarin Katharina II.
Wenige Meter entfernt erlaubt das Porträt der Mrs. Lowndes-Stone von Thomas Gainsborough aus dem Jahr 1775 einen interessanten Vergleich mit Rubens. Das Porträt Gainsboroughs gehört zu seinem Spätwerk, der Londoner Periode, in der er mit flüssigem Pinselstrich und hellen Lichtflecken die Spontaneität der Landschaftsmalerei des neunzehnten Jahrhunderts vorweggenommen hat.
Aus den weiteren Gemälden des achtzehnten Jahrhunderts möchte ich Fragonards „Liebesinsel“ herausheben, wobei man bei Nennung des Titels sicherlich zuerst an Watteau denkt. Aber Fragonards Landschaftsbild ist beunruhigend und viel dramatischer als zum Beispiel Watteaus „Einschiffung nach Kythera“. Im Vordergrund sieht man Stromschnellen eines Flusses, auf dem eine große Gondel mit Menschen unterwegs ist. Aber ob sie zu der Insel fahren oder ob sie sie verlassen haben (dann wäre die Landschaft im Hintergrund Teil der Liebesinsel), kann man nicht erkennen.
Den Übergang zu den Räumen des neunzehnten Jahrhunderts markiert eine Marmorskulptur der Diana von Houdon, die früher auch zur Sammlung der russischen Zarin Katharina II. gehörte und in der Hermitage in Sankt Petersburg ausgestellt war. Houdon griff mit der Darstellung der Göttin der Jagd ein in Frankreich beliebtes Thema auf – man denke nur an das Porträt der Diane de Poitiers aus der Schule von Fontainebleau. Allerdings hat Houdon das Motiv sehr originell verändert: Diana rennt. Dadurch berührt sie nur mit einem Fuß den Boden, was den Künstler zwang, einen Strauch zur Abstützung des Körpers hinzuzufügen.
Das neunzehnten Jahrhundert ist mit vielen bekannten Künstlern vertreten. Erwähnen möchte ich drei Gemälde: „Die Seinemündung“ von Turner, ein ganz ungewöhnliches Bild eines wenig bekannten Malers und den „Spiegel der Venus“ von Edward Burne-Jones.
Bei dem wenig bekannten Maler handelt es sich um Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, und bei seinem ungewöhnlichen Bild mit dem Titel „Les Bretonnes au Pardon“ um eine Gruppe sitzender Frauen in schwarzen Kleidern und weißen Hauben. Die Frauen sitzen auf einer Wiese, im Hintergrund sieht man eine Kirche, und neben der Gruppe stehen zwei junge Männer, die die Frauen beobachten oder bewachen, aber deren Gesichtszüge nicht ausgeführt sind. Offenbar handelt es sich um eine religiöse Zeremonie, bei der den Frauen, die gesündigt hatten, Pardon gegeben, bzw. eine Strafe erlassen wurde. Das Besondere an dem naturalistischen Bild ist das Gesicht der in der Mitte sitzenden Frau, die als Einzige uns, die Betrachter, anblickt mit einer Mischung aus Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit, Verzweiflung und Müdigkeit, wie ich es selten auf einem Gemälde gesehen habe.
„Der Spiegel der Venus“ von Burne-Jones bildet den Abschluss der ausgestellten Sammlung. Das für die Malweise des Engländers vergleichsweise farbkräftige Bild ist das einzige Exemplar präraffaelitischer Malerei und hängt etwas verloren zwischen den französischen Werken.
Wer jetzt bildgesättigt die Ausstellungsräume verlässt, übersieht die Tür zu einem kleinen Nebenraum, in dem wunderbare Jugendstil- und Art déco-Schmuckkreationen von René Lalique betrachtet werden können.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Gulbenkian Museum eine außergewöhnliche Sammlung klassischer Kunst in einem Gebäude der Moderne präsentiert.
Viele der bedeutendsten Museen Europas hatten ihren Ursprung in fürstlichen Sammlungen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Nur wenige Museen entstanden aus bürgerlichen Initiativen ohne den Grundstock einer umfangreichen Privatsammlung. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Museum der bildenden Künste in Leipzig, ein anderes ist das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld. 1883 wurde der Crefelder Museumsverein mit dem Ziel gegründet, ein Museum für Kunst zu betreiben und ein Gebäude dafür zu errichten. Mit vielen Spenden konnte der Bau verwirklicht und 1897 als Kaiser Wilhelm Museum und Denkmal für Kaiser Wilhelm I. eröffnet werden. Die Kunstobjekte kamen nach und nach aus Schenkungen einzelner Werke und Stiftungen zusammen, woraus sich auch die Heterogenität der Bestände erklärt. Als gemeinsamen Nenner kann man höchstens eine Ausrichtung auf deutsche Kunst erkennen, und so war es nicht verwunderlich, dass 1907 der Ankauf eines Gemäldes von Monet (einer Fassung seines heute berühmten Sonnenuntergangs hinter dem Parlament in London) als Versuch, Anschluss an die Moderne zu finden, große Empörung auslöste. Auch in den 1920er Jahren hatte es die durchaus aufgeschlossene Museumsleitung schwer, expressionistische und zeitgenössische Kunst anzukaufen. Trotzdem fielen etwa einhundert Arbeiten den nationalsozialistischen Säuberungen zum Opfer. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die Museumsleitung, die klassische Moderne nachzuholen, und setzte danach ganz auf zeitgenössische Kunst. So kamen Yves Klein und Jean Tinguely nach Krefeld.
Nach vierjähriger Schließung für Sanierungs- und Umbauarbeiten wurde das Museum 2016 mit einer Sonderausstellung unter dem Titel „Das Abenteuer unserer Sammlung I“ neu eröffnet. Da Paul Land über eine Führung durch diese Ausstellung bereits im vergangenen Herbst eine Zusammenfassung geschrieben hat, sei hier nur kurz erwähnt, dass ein Höhepunkt der Neueröffnung zweifellos die Freilegung des vierteiligen Lebensalterzyklus von Johan Thorn-Prikker aus dem Jahr 1923 war. (Das weitere Schicksal dieses Werks ist typisch für die wechselhafte Bewertung von Kunst. In den 30er Jahren wurde es abgedeckt und entging so der Beschlagnahmung. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde es freigelegt, aber 1970 wieder verdeckt, weil es dem Zeitgeist nicht entsprach.) In vielen Räumen wurden Gemälde und auch Skulpturen im Kontrast präsentiert. In einem der schönsten Räume beispielsweise hingen und standen Aluminium-Objekte von Kiki Smith, während an den Wänden zwei spätgotische (von Derick Baegert) und ein manieristisches Gemälde (von Aertgen van Leyden) hingen. Insgesamt warteten viele Überraschungen auf den Besucher. Zu den Missgriffen der Hängung gehörte dagegen die Plazierung des wahrscheinlich wertvollsten Gemäldes der Sammlung, des schon erwähnten Sonnenuntergangs von Monet, fast versteckt in einem kleinen Seitenraum.
Jetzt wurde die Sonderausstellung „Das Abenteuer unserer Sammlung I“ abgelöst von der Fortsetzung „Das Abenteuer unserer Sammlung II“. Dafür wurden mit wenigen Ausnahmen die Objekte durch eine andere Auswahl ersetzt – zu den Ausnahmen gehören der Lebensalterzyklus von Thorn-Prikker und Monets Sonnenuntergang, den man darüber hinaus nicht mehr so stiefmütterlich behandelt, sondern ihm einen angemessenen Platz in der Sichtachse eines zentralen Raums eingeräumt hat. In diesem Raum wird der Monet mit dem Porträt der Gründungsspenderin Marianne Rhodius, mit dem schönen Landschaftsbild „Stille vor dem Sturm“ von Hans Thoma und mit der großformatigen „Germania als Wacht am Rhein“ von Lorenz Clasen konfrontiert. Betrachtet man dieses berühmte Bild näher, könnte man leicht vermuten, William Marston, der Erfinder des Lügendetektors und der Comic-Figur Wonder Woman, habe die Germania gekannt und als Vorlage benutzt. Zu groß sind die Ähnlichkeiten bezüglich des Blicks, der Haltung und der Bewaffnung zwischen der Germania und Wonder Woman, die zur Zeit in den Kinos Furore macht.
Als bemerkenswert sind mir noch zwei Bilder von Alfred Mohrbutter und „Der Besuch“ von Heinrich Nauen aufgefallen. Nicht entgehen lassen sollte man sich auch die Wayang-Puppen des indonesischen Schattentheaters, die einen ganzen Raum für sich haben.
Seit einigen Jahren gehören zum Krefelder Museum mit dem Haus Lange und dem Haus Esters zwei Villen, die von Mies van der Rohe um 1930 gebaut wurden und heute für Sonderausstellungen genutzt werden. Im Haus Lange läuft gegenwärtig unter dem Titel „Die Zugezogenen“ ein Spiel zwischen Realität und Fiktion, der Einzug einer Familie, die offensichtlich wegen des Brexits aus England geflüchtet ist … Zusammenfassend kann man zum Krefelder Museum sagen, dass in einem klassizistischen Gebäude der Gründerjahre eine äußerst heterogene Sammlung mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Kunst untergebracht ist und dass das Museum sich zum Ziel gesetzt hat, die Vielfalt der aktuellen Kunstströmungen beispielhaft immer wieder neu zu zeigen.
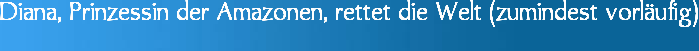
Diana, Prinzessin der Amazonen, Tochter der Königin Hippolyta, hierzulande besser bekannt als Wonder Woman, ist in der jetzt angelaufenen Filmfassung die erste weibliche Hauptfigur eines Superheldenblockbusterspektakelfilms, bei dem darüber hinaus auch eine Frau Regie führte – Patty Jenkins, die 2003 den Film „Monster“ über die erste weibliche Serienmörderin mit Charlize Theron in der Hauptrolle gedreht hatte.
Im Film „Wonder Woman“ über die Anfänge ihrer Abenteuer ist der Kriegsgott Ares Dianas schlimmster Feind, den sie besiegen und töten muss, um die Welt zu retten. Dabei sind den Drehbuchautoren Nachlässigkeiten unterlaufen. In der griechischen Mythologie ist nämlich die Amazonenkönigin Hippolyta die Tochter des Kriegsgottes Ares, und demnach wäre Diana seine Enkelin. Dummerweise ist aber die mythologische Diana eine römische Göttin und wäre der griechischen Artemis (der Göttin der Jagd und Schwester Apolls) gleichzusetzen. Als Göttin der Jagd wurde sie in der bildenden Kunst oft dargestellt. Besonders berühmt ist ein Gemälde aus der Schule von Fontainebleau, auf dem Diane de Poitiers, die Geliebte Heinrichs II., nackt zur Jagd schreitet. In einem anderen Universum wiederum wurde Hippolyta von Theseus gefangengenommen und zur Ehe mit ihm gezwungen – diese Version kennen wir alle aus dem Sommernachtstraum. Übersehen werden dagegen die meisten Kinobesucher wahrscheinlich, dass in einer kleinen Nebenrolle auch Penthesilea auftaucht, die in der Mythologie eine bedeutende Rolle spielte: Sie war die Nachfolgerin Hippolytas als Amazonenkönigin, kämpfte im Trojanischen Krieg gegen die Griechen und wurde von Achill getötet (bei Kleist hinwiederum Achill von ihr).
Da Wonder Woman 1941 das Licht der Welt erblickt hat, ist sie heute eigentlich schon eine ziemlich alte Frau. Entstanden ist sie, weil die USA im Jahr zuvor einen regelrechten Superheldenboom erlebt hatten – nach den Erfolgen von Superman (*1937) und Batman (*1939) waren sieben neue Serien erschienen.
Im Lauf der Jahrzehnte haben sich ihre Einsatzgebiete, ihre überirdischen Kräfte, ihr Aussehen und ihre Bekleidung mehrfach drastisch geändert. Anfangs kämpfte sie für Frauenrechte und Demokratie, und zu ihren Waffen gehörte ein Lasso, das einen damit Gefangenen zwang, die Wahrheit zu sagen, und zwei silberne Armreifen, mit denen sie Kugeln und Patronen abwehren konnte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren ihre Superkräfte nicht mehr gefragt, sie wurde zur Babysitterin und Sekretärin mit roten Bäckchen degradiert, die sich von tapferen Männern aus gefährlichen Situationen retten lassen musste. In den sechziger Jahren wurde sie zu einer James Bond ähnlichen Spionin umgestaltet. Erst 1972 besann man sich auf die Anfänge, in denen Wonder Woman sogar amerikanische Präsidentin geworden war, und die Feministin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem machte sie zum Titelbild der ersten Ausgabe ihres Ms-Magazins mit dem Aufruf „Wonder Woman for President“. 1975 startete die erste Fernsehserie, in der Lynda Carter nicht sehr erfolgreich die Hauptrolle spielte – nach drei Staffeln wurde die Serie eingestellt. Dem nachlassenden Publikumsinteresse begegnete der Verlag in den folgenden Jahren mit häufigen Änderungen, Wonder Woman bekam ihre Muskeln zurück oder wurde als Punk oder im schwarzen Leder-Outfit gezeichnet. Filmableger (wie zum Beispiel Catwoman mit Halle Berry oder Elektra mit Jennifer Garner, die vorher erfolgreich in Alias gespielt hatte) floppten an der Kinokasse, thematisch verwandte Fernsehserien (Bionic Woman, Painkiller Jane, Dark Angel z. B.) liefen auch nicht lange, und neue Drehbücher für einen Spielfilm über Wonder Woman wurden abgelehnt, weil die Meinung entstanden war, mit weiblichen Superhelden ließe sich kein Geld verdienen – höchstens als Mitgliedern eines Teams wie die von Scarlett Johansson gespielte schwarze Witwe in den Avengers-Filmen. Der Umschwung kam wahrscheinlich erst mit den Hunger Games und Jennifer Lawrence sowie beispielsweise dem vierten Film aus der Mad-Max-Serie und Charlize Theron als Furiosa.
So interessant wie die Veränderungen der Rolle sind auch die Veränderungen ihrer Kleidung: Anfangs trug sie ein rotes Bustier, ein kurzes blaues Röckchen mit weißen Sternchen und rote Stiefelchen. Schon bald wurde das Röckchen durch eine Art Pluderhose hässlich ersetzt. Diese Bekleidung war ziemlich lächerlich und drückte weder Erotik noch Selbstbewusstsein und Stärke aus. In der James-Bond-Zeit bekam sie schwarze Lederhosen mit schwarzen Stiefeln spendiert, das Bustier verschwand unter einem Pullover oder Blazer, und die Haare wurden blauschwarz. Das Bustier von Lynda Carter war goldfarben und tief dekolletiert, kein Schutz mehr, sondern nur ein Mittel, um die Brüste zu präsentieren.
Jetzt ist sie also wieder da, eine sehr schöne Amazone, aufgewachsen auf einer Insel ohne Männer, großes Selbstbewusstsein ausstrahlend, mit der Fähigkeit, Geschosse abzulenken und ein Dutzend Gegner mit dem Schwert in Schach zu halten. Ihr in einem dunklen Rot gehaltenes Bustier bedeckt die Brust vollständig und kann als Schutzpanzer durchgehen, und der dunkle Lendenschurz macht ihre Beine nicht zur vorrangigen voyeuristischen Zielscheibe.
Natürlich ist die israelische Filmschauspielerin Gal Gadot ein erotisches Objekt der Begierde, aber sie ist durch das eigene Selbstverständnis ihrer Kraft auch etwas völlig anderes als alle ihre Vorläuferinnen. Gal Gadot ist in der Rolle großartig. Manchmal ähneln ihre Gesichtszüge Angelina Jolie. Aber während ein Lächeln Jolies oft aus einer Mischung von Hochmut, Geringschätzung, Herablassung und Spott besteht, kann Gadot einfach nett lächeln und glaubwürdig Mitleid zeigen.
Der Film war seit seinem Start sehr erfolgreich und hat Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson schnell überholt. Schon jetzt ist von einer Fortsetzung die Rede. Gal Gadot hätte sie verdient. Hoffentlich finden die Drehbuchschreiber einen besseren Plot.
Weiterführende Literatur:
Eliana Dockterman: Wonder Woman breaks through; TIME Jan. 2, 2017
Jill Lepore: The Secret History of Wonder Woman; 2015
Adrienne Mayor: The Amazons; 2014
(Juni 2017)
Anlässlich des Kinostarts von „Ghost in the Shell“ mit Scarlett Johansson als Cyborg mit menschlichem Gehirn hat in der FAZ Dietmar Dath wieder einmal einen seiner verschwiemelten Texte geschrieben. Schon zu Beginn greift er tief in die Kiste gehobener Bildung und benutzt René Descartes, sein Dogma vom Graben zwischen Leib und Seele sowie Hegels „Phänomenologie des Geistes“ als Messlatten für seinen Kommentar.
Auf D. D. wurde ich vor etwa fünfzehn Jahren aufmerksam, als von ihm in der FAZ ein langer, fast eine ganze Seite umfassender Text über französische Science Fiction erschien. Das war geradezu revolutionär – wenigstens erinnere ich mich nicht, vorher dem SF-Thema in der FAZ begegnet zu sein. Wenn das keine Eintagsfliege ist, d. h. kein Einmalartikel eines freien Mitarbeiters, dachte ich, könnte der Autor zu einer Bereicherung des Frankfurter Feuilletons werden. Wurde er, zeigte sich vielseitig und sehr kenntnisreich, was die Science Fiction der vorausgegangenen zwanzig bis dreißig Jahre betraf. Nach einigen Jahren verließ er die Zeitung, kam aber zurück und machte da weiter, wo er aufgehört hatte: So schrieb er zum Beispiel schon nach Abschluss der ersten Staffel über „Game of Thrones“ – lange bevor die Serie von anderen Zeitungen als Thema aufgegriffen wurde. Von Anfang an verwendete er eine eigene Sprache, man stolpert in seinen Texten über ungewöhnliche oder merkwürdige Aufzählungen und Wortkombinationen. So erfand er für Popcorn-Fantasy-Filme den Begriff Spektakeldrama. Hier ein Beispiel aus einer Filmbesprechung: „Vor allem aber hat Argento, den auch seine hingebungsvollsten Fans in akademisch-linken Kreisen nicht mit einem Feministen verwechseln würden, die immanente Misogynie des frauenfressenden Genres dazu benutzt, die Frage „Wie hässlich ist Schönheit?“ mitten auf der Kreuzung zwischen Männerrolle und Frauenrolle, Kunst und Natur und drei Dutzend anderen schmerzhaften Gegensatzpaaren zu stellen, statt sich wie Refn von Softporno-Glanzpapier-Modestrecken vorschreiben zu lassen, wie grell er die Küsse zwischen Sex und Tod inszenieren darf.“ Alles klar?
Entsprechend sein Text über Ghost in a Shell. Viele Bemerkungen kreuz und quer über Einzelheiten wie die Fütterung eines Rudels halbverhungerter Großstadthunde. Immerhin erfährt man so die Namen der japanischen Vorbilder, eines Mangas und der Anime-Filme Kokaku Kidotai und Inosensu. Aber eine vernünftige Inhaltsangabe, worum es geht, wird dem Leser nicht geboten. Nicht mal eine kurze in zwei Sätzen, als wisse der Verfasser, dass ein Leser seines Textes keinen Wert auf eine Inhaltsangabe lege. Worum geht es? Major, die Hauptfigur, ist eine neugeschaffene Kampfmaschine, ein Roboter, dem man ein menschliches Gehirn eingebaut hat, und soll im Auftrag des japanischen Verteidigungsministeriums Cyberterroristen zur Strecke bringen. Dann stellt sich heraus, dass der Hauptverbrecher aus den eigenen Reihen kommt. Parallel spürt Major ihrer Vergangenheit nach, erhält aber nur ausweichende Antworten, bis sie ihre Mutter trifft und außerdem herausfindet, dass sie keine Einzelschöpfung ist, sondern das erste erfolgreiche Versuchsmodell in einer langen Reihe von Vorläufern und dass das junge Mädchen, das sie einmal war, grundlos getötet wurde. Aus diesem Handlungsstrang hätte man viel mehr machen können, aber der Regisseur hat stattdessen leider gefühlte 50% der Zeit für die üblichen albernen Verfolgungsjagden und Kugelhagel-Ballette vergeudet.
Die Kritiken waren überwiegend negativ. Beispielsweise brachten die visuellen Effekte (vor allem die immer wieder von oben gezeigte Stadt, die stark an den Film „Das fünfte Element“ erinnern) einen Besprecher in der Zeit dazu, den Film als Augenwurm zu bezeichnen. Positive Bewertungen wie in The Times hoben hervor, dass mit Major endlich eine weibliche Superheldin geschaffen worden sei, die ihren männlichen Pendants Paroli bieten könne. Obwohl Scarlett Johansson allgemein gelobt wird und Erfahrung in vergleichbaren Rollen gesammelt hat (Under the Skin, Lucy, Avengers) hätte ich lieber Alicia Vikander, die als Roboter Ava in Ex Machina brillierte, in der Rolle gesehen.
(Im April 2017)

In einem Regal des Bücherschranks meiner Großeltern stand zwischen Thomas Manns Buddenbrooks, Ina Seidels dickem Wunschkind, Adalbert Stifters Nachsommer und seinem Sanften Gesetz sowie Bänden von Uhland und Mörike auch Der grüne Heinrich von Gottfried Keller. Im Alter von etwa zwölf bis siebzehn Jahren habe ich den Bücherschrank systematisch durchstöbert, die verschiedenen Bände mehrmals aus dem Schrank genommen und zu lesen begonnen. Aber bei keinem bin ich nach meiner Erinnerung über die ersten zehn Seiten gekommen. Ich fand sie schlicht zu langweilig oder zu umständlich geschrieben. Selbst die Schullektüre von Kellers Novelle Kleider machen Leute in der Mittelstufe brachte mich nicht dazu, den grünen Heinrich weiterzulesen. (Gelesen habe ich stattdessen Eltern und Kinder von Peter Stühlen und Die Heilige und ihr Narr von Agnes Günther – beide mindestens zweimal. Zu meiner eigenen Ehrenrettung muss aber erwähnt werden, dass ich Stifters Nachsommer seit langem außerordentlich schätze.)
Da mein Großvater bei einigen seiner Bücher das Datum des Erwerbs vermerkt hatte, bin ich beim Durchblättern der anderen Bücher oft der Frage nachgegangen, wann er und Großmutter wohl ein bestimmtes Buch erworben und vielleicht auch gelesen haben. Bei einer Reihe von Büchern ließ sich die Frage nie beantworten, weil die Jahreszahl der Drucklegung nicht angegeben war und auch die Umschlagsgestaltung keine Schlussfolgerungen zuließ. Auch die Ausgabe des grünen Heinrichs weist keine Jahreszahl auf, aus der man die Drucklegung erkennen könnte. Gesetzt ist der Text in Fraktur, die sowohl im 19. Jahrhundert als auch einige Jahre im Dritten Reich verwendet wurde, bevor Bormann sie als Judenschrift diffamierte und die deutschen Verlage zur Antiqua zurückkehrten, die sie schon in der Zeit von etwa 1905 bis 1932 verwendet hatten. (So ist beispielsweise Buddenbrooks aus dem Fischer Verlag in der Auflage von 1904 in Fraktur gesetzt, während die 1907 auch bei Fischer erschienene fünfbändige Ausgabe von Ibsens Sämtlichen Werken in Antiqua gedruckt wurde.) Aus den Mustern auf dem roten Buchrücken mit Goldprägung, die man weder dem Jugendstil noch dem Art déco zuordnen kann, lässt sich die Zeit der Herstellung auch nicht abschätzen. So könnte mein Großvater den Roman um 1900 herum erworben haben oder – was ich für wahrscheinlicher halte – meine Großmutter erst in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg.
Ich hätte mich wahrscheinlich nie mehr mit Gottfried Keller beschäftigt, wenn Der grüne Heinrich nicht vor einigen Jahren in einer Zeitungsserie mit dem Titel „Durchs Jahrhundert des Romans “ behandelt worden wäre. Statt einer Skizze des Handlungsverlaufs enthielt der Zeitungstext jedoch nur die Beschreibung einer nächtlichen Badeszene im Mondlicht und den Hinweis, dass es vom grünen Heinrich zwei Fassungen gäbe, die stark voneinander abwichen. Die schöne nächtliche Szene stamme aus der ersten Fassung, sei aber in der zweiten Fassung der Selbstzensur Kellers zum Opfer gefallen und gestrichen worden. In der ersten Fassung verließe Heinrich die Badende und gehe allein zugrunde. In der zweiten Fassung dagegen gehe er nicht zugrunde und Judith (die Badende) komme sogar zu ihm zurück.
Aufgrund dieser Hinweise nahm ich zum ersten Mal nach vielen Jahren das Exemplar aus dem Bücherschrank meines Großvaters zur Hand und fand anhand der Kapitelüberschriften und des Schlusskapitels schnell heraus, dass es sich um die zweite Fassung handelte. Neugierig geworden kaufte ich eine Ausgabe der ersten Fassung und stellte sie neben den anderen Band, verschob aber die Lektüre auf einen unbestimmten zukünftigen Tag. Seitdem sind mehr als zehn Jahre verstrichen. Kürzlich aber – aus einer unerklärlichen Laune heraus – habe ich begonnen, beide Versionen zu lesen. Sie unterscheiden sich tatsächlich inhaltlich beträchtlich. Während ein Ich-Erzähler die Geschichte in der zweiten Fassung chronologisch berichtet, wird die erste Fassung aus wechselnden Perspektiven erzählt. Begonnen und beendet wird sie von einem auktorialen Erzähler. Eingeschoben ist das Manuskript eines Ich-Erzählers über seine Kindheit und Jugend. Mit diesem Perspektivwechsel und der Rückblende war Keller schon vor Abschluss des Romans unzufrieden, diese Unzufriedenheit war die Hauptantriebskraft für eine zweite Fassung. Zwar endet diese versöhnlicher als die erste, aber der Kern der Handlung hat sich dabei nicht geändert. Keller hat einen Entwicklungs- und Bildungsroman geschrieben, in dem der Protagonist am Leben kläglich scheitert und seine Träume, ein erfolgreicher Kunstmaler zu werden, zerstieben. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen romantischen Künstlerroman, sondern um die Beschreibung eines Desillusionierungsprozesses, weil Heinrich sein Festhalten an der Idee, er sei zum Künstler berufen, als Selbsttäuschung erkennt. Er scheitert aber nicht nur beruflich, sondern auch bei seinen Versuchen, eine Liebesbeziehung einzugehen, weil er davor im Grunde ängstlich zurückschreckt. Diese Passagen mit Zögern, Abwägen und Ausflüchten sind besonders interessant, mit großem Realismus beschrieben und für einen Roman aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr ungewöhnlich.
Auch sprachlich unterscheiden sich die Fassungen. Die erste Fassung wirkt sperriger als die zweite, dafür aber findet man darin herrliche Worterfindungen wie zum Beispiel Augengrobheit oder Ungeschmack.
Ich bin noch am Lesen und habe mir kein abschließendes Urteil gebildet … aber ich glaube, dass mir die erste Fassung besser gefällt.
(Im März 2017)

Vor zwanzig Jahren zeigte die Städtische Galerie im Münchner Lehnbachhaus eine Ausstellung mit dem Titel: Der Kampf der Geschlechter. Versammelt waren 140 Werke (Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik-Serien und einige Skulpturen) hauptsächlich aus der Zeit zwischen 1880 und 1920.
Werke von Stuck, Munch, Klinger, Redon, Rops und Moreau bildeten die Schwerpunkte. Die Bildauswahl war breit, brachte aber wenig Überraschungen, die meisten Gemälde und die Druckgraphik-Serien (von Klinger, Kubin und Vallotton) waren ziemlich bekannt. Lediglich der Umfang provokanter Zeichnungen von Félicien Rops dürfte manchen Besucher schockiert haben.
Begründet wurden Konzept und Werkauswahl der Ausstellung mit den Strömungen der Zeit des 19. Jahrhunderts: den gängigen Diskriminierungen der Frau (durch Schopenhauer usw.), der Ausbreitung des Symbolismus, der Erfindung der Femme fatale, den Spannungen aufgrund der Rechtsstellung der Frau im Deutschen Kaiserreich sowie den einsetzenden Gegenbewegungen zur Frauenemanzipation.
Jetzt hat das Frankfurter Städelmuseum das Thema aufgegriffen und präsentiert unter dem ähnlichen Namen „Geschlechterkampf“ rund 200 Kunstwerke aus vergleichbarem Zeitraum. Ergänzend werden Filmausschnitte gezeigt, und der Endpunkt wurde bis ins Jahr 1949 hinausgeschoben. Die Auswahl der Künstler für die Zeit um die Jahrhundertwende ähnelt der Münchner Ausstellung – mit der Ausnahme von Redon, der in Frankfurt nicht berücksichtigt wurde.
Gezeigt werden die Werke in zwölf Räumen, die jeweils entweder einem einzigen Künstler wie Stuck, Munch, Rops oder der Fotografin Lee Miller gewidmet sind oder ein besonderes Thema wie z. B. Adam und Eva, Sphinx, Tödliche Verführung, Schock des Realen, Hure oder Heilige, Lustmord und Prostitution, Rollenbilder im Wandel (über die 20er Jahre) oder Sexualität im Surrealismus behandeln.
Die Ausstellung beginnt mit einer Adam-und-Eva-Darstellung. Während in München zu dem Thema ein Gemälde von Ludwig Thoma zu sehen war, auf dem sich der Tod mit bereits aufgespanntem Leichentuch als dritte Person eingefunden hat, zeigt Frankfurt ein Bild von Franz von Stuck, das nicht zu seinen besten Werken gehört. (Evas Körper ist knabenhaft schlank, fast androgyn, und die blaue Schlange, die Adam den Apfel in ihrem Maul präsentiert, sieht eher wie ein Strickstrumpf aus.) Entschädigt wird der Besucher durch ein Bild des Dänen Julius Paulsen, das die erste Begegnung von Adam und Eva zeigt. Erstaunen und Neugier sind perfekt gemalt. Betrachtenswert sind auch eine „Lilith mit Schlange“ (Adams erste Frau; Symbol der Emanzipation) von John Collier und eine Apfelszene von Suzanne Valadon, wobei die Blicke Fragen aufwerfen. Adam schaut nämlich unbeteiligt und leicht verbissen ins Irgendwo, als ginge ihn alles nichts an, und Eva pflückt zwar gerade den Apfel, blickt aber pausbäckig nach oben ins Geäst des Baumes. (In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die „modernste“ malerische Fassung von Adam und Eva viel älter ist, ich meine das Diptychon von Dürer im Prado mit bemerkenswerten Details: Adam und Eva stehen hier nicht nebeneinander in einem Bild, sondern sind getrennt, jeder steht für sich allein; Eva pflückt den Apfel nicht, die Schlange hat ihn gepflückt und präsentiert ihn ihr im Maul; Eva hat nach dem Apfel gegriffen, aber übergibt ihn Adam nicht; doch der Apfel taucht ein zweites Mal auf, Adam hat ihn schon und hält den abgebrochenen Zweig, an dem der Apfel hängt, mit gespreizten Fingern fest, die andere Hand ist in Abwehrhaltung; unentschlossen und voller Unsicherheit blickt er nach Eva; aber wie und wohin blickt sie? Ihr Blick ist vieldeutig, abwartend, neugierig, selbstbewusst, ziemlich emanzipiert.)
Der zweite Raum ist der Sphinx gewidmet. Wie schon in München wird auch in Frankfurt von Gustave Moreau eine Spätfassung des Themas „Ödipus und die Sphinx“ gezeigt. Keine glückliche Wahl: Ingres und Moreau in einer früheren Version haben die Gestalt der Sphinx besser getroffen. (Eine Sphinx zu malen, ist offensichtlich ein schwieriges Unterfangen. Auch Khnopffs bekannter Versuch ist nicht so recht gelungen.) In diesen Raum hätte ein weiteres Werk von Stuck gut gepasst: Der Kuss der Sphinx. In diesem Hauptwerk aus dem Jahr 1895 ist der Mann nicht mehr der Bezwinger der Sphinx, sondern willenloses Opfer des zwitterhaften Ungeheuers, der diesen Zustand aber wohl mit Lust genießt. Hier hat Stuck eine neue Radikalität erreicht, die ihn in die Nähe Munchs bringt. Stattdessen werden zusätzlich andere weibliche Killerinnen gezeigt: eine Salome mit dem Kopf des Johannes, eine Klytämnestra mit der Mordwaffe und noch blutbeflecktem Gewand sowie eine Horde von Mänaden. Pentheus ist schon auf der Flucht. Aber die Geschichte geht bekanntlich nicht gut für ihn aus.
Der nächste Raum ist Franz von Stuck ganz vorbehalten und zeigt unter anderem eine Version seiner „Sünde“, eine „Verwundete Amazone“ und eine „Judith“, die dabei ist, Holofernes den Kopf abzuschlagen. Ihr genüssliches Lächeln vor dem Mord passt aber gar nicht zu der biblischen Geschichte der gottesfürchtigen Witwe.
Der Femme fatale huldigen Klinger, Kubin, Beardsley, Mossa und ein halbes Dutzend weiterer Künstler, die man nicht unbedingt kennen muss. Am eindrucksvollsten vielleicht Gustav Adolf Mossa mit dem Gemälde „Sie“, einer Kindsfrau, die auf einem blutigen Leichenberg thront.
Einen eigenen Raum, an dessen Eingang der Führer unserer Gruppe schnell vorbeiging, hat der Belgier Félicien Rops erhalten. Zu sehen sind dreizehn Zeichnungen, darunter sein Hauptwerk „Dame mit Schwein“: Mit hoch erhobenem Haupt, aber verbundenen Augen führt eine weitgehend nackte, nur mit schwarzen Strümpfen und schwarzen Handschuhen bekleidete Frau ein rosiges Schwein mit Ringelschwanz an der Leine spazieren. Aus Gründen der guten Sitten sei hier auf eine Beschreibung der übrigen Bilder von Rops verzichtet.
Zu den Überraschungen der Frankfurter Ausstellung gehören Jeanne Mammen und Lee Miller. Von der Berliner Künstlerin Jeanne Mammen (1890 bis 1976) hatte ich vorher nie gehört. Die ausgestellten symbolistischen Aquarelle stammen alle aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und erinnern teilweise an Motive von Rops. Lee Miller (1907 bis 1977) war eine amerikanische Fotografin, die den Vormarsch der US-Army am Ende des zweiten Weltkriegs begleitete und im Auftrag der Vogue Aufnahmen der zerstörten deutschen Städte machte. Berühmt wurde ein Foto eines Kollegen, der sie im April 1945 in der Badewanne Hitlers in dessen Münchner Wohnung aufgenommen hatte. Die meisten der in der Frankfurter Ausstellung gezeigten Fotos stammen jedoch aus der Zeit um 1930 und besitzen einen surrealistischen Einschlag – was nicht verwundert, wenn man weiß, dass Miller in der Zeit mit Man Ray in Paris gelebt und gearbeitet hatte.
Einen eigenen Raum hat auch Edvard Munch erhalten. Bekannte und unbekannte Gemälde kreisen um Liebe, Schmerz und Eifersucht.
Unter dem Titel „Der Schock des Realen“ werden unterschiedliche Künstler mit unterschiedlichen Themen präsentiert. Darunter Corinth, Kollwitz, Liebermann, Slevogt und v. Keller. Die 20er Jahre werden in Werken von Dix, Höch, Hubbuch, Kokoschka und anderen nur lückenhaft gespiegelt.
Das Thema „Sexualität im Surrealismus“ bildet den Abschluss der Ausstellung. Zu sehen sind ein Meisterwerk von Max Ernst, die „Einkleidung der Braut“ und seine in einem Wettbewerb mit Dali entstandene „Versuchung des heiligen Antonius“, außerdem u. a. Versionen der Puppe von Hans Bellmer, Fotos von Man Ray, „Der kleine Hirsch“ von Frida Kahlo und als abschließendes Bild „Das Ende der Welt“ von Leonor Fini aus dem Jahr 1949.
Es fiel mir bei dem Besuch schwer, in den Räumen, die das Ausstellungsthema mit Kunstwerken des zwanzigsten Jahrhunderts darstellen, eine klare Linie zu finden, und bei mehr als einem Bild konnte ich den Bezug zum Thema nicht erkennen. Vielleicht wäre weniger mehr gewesen. Andererseits fehlen Schlüsselwerke für die 20er Jahre und die „Neue Sachlichkeit“ wie z. B. „Domina mea“ von Rudolf Schlichter, „Selbstbildnis“ von Christian Schad, „Freundinnen“ von Radziwill und „Vorstellung“ von Niklaus Stoecklin.
(Februar 2017)

Wer Orwells „1984“ gelesen hat, wird den Anhang über Neusprech (Newspeak) vermutlich nie vergessen. Neusprech war die offizielle Sprache von Ozeanien, die aus dem alten Englisch entwickelt worden war, um den ideologischen Bedürfnissen des Herrschaftsapparates Engsoz (des Englischen Sozialismus) gerecht zu werden. Ziel der Einführung von Neusprech war, alle Ausdrücke der persönlichen Meinung zu unterbinden und damit den freien Willen und das Denken einzuschränken. Als Mittel dienten dazu die Reduzierung des Wortschatzes und die Verminderung oder Änderung der Wortbedeutungen. So durfte das Wort „frei“ nur mit sehr eingeengter Bedeutung verwendet werden wie beispielsweise: „Dieses Beet ist frei von Unkraut.“ Frei durfte nicht im Sinn politischer oder persönlicher Freiheit gebraucht werden. Da es keine politische und geistige Freiheit mehr gab – nicht einmal als Konzept – war die Notwendigkeit für die Benutzung entfallen. Es wurde aus allen Texten getilgt, und wer sich noch daran erinnerte und es dennoch verwendete, wurde als Häretiker angesehen und bestraft.
Orwells düsteren Roman habe ich schon vor Jahrzehnten im Englischunterricht in der Oberprima gelesen. Seitdem war mir kein Buch begegnet, in dem die Sprache vergleichbar der eigentliche Akteur einer Romanhandlung war oder das man als einen Vorläufer von „1984“ hätte ansehen können, bis mir jetzt die Neuübersetzung von Andrej Platonows Roman „Die Baugrube“ in die Hände fiel.
Platonow, der von 1899 bis 1951 lebte, war ein russischer Schriftsteller, dessen Roman unter Stalin nicht erscheinen durfte und erst lange nach seinem Tod gedruckt wurde. „Die Baugrube“ gilt als sein Hauptwerk, das er im Alter von 30 Jahren geschrieben hat (also etwa 15 Jahre, bevor Orwell „1984“ begann). Publiziert wurde es zum ersten Mal 2010, sechzig Jahre nach seinem Tod.
Im ersten Teil heben Arbeiter am Rande einer Stadt eine tiefe Grube aus, die das Fundament eines großen Hauses mit Wohnungen, eines Paradieses für alle Proletarier, aufnehmen soll. Im zweiten Teil verlassen die Arbeiter die Baugrube und ziehen aufs Land, um einer Dorfbevölkerung bei der von Stalin angeordneten Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und der Enteignung und Vernichtung der Kulaken (der Großbauern) zu helfen. Ein unter den Arbeitern lebendes Waisenkind steht für die Hoffnung auf den „neuen Menschen“ der nächsten Generation, verhungert jedoch und wird an der tiefsten Stelle der Baugrube beerdigt. Ob die Baugrube auch zum kollektiven Grab der Arbeiter wird, bleibt offen.
Als Platonow den Roman schrieb, hatte sich die russische Sprache als Folge der Revolution tiefgreifend verändert. Der Autor entlarvt gnadenlos die Leere der Phrasen der pseudophilosophischen und parteiideologischen Texte und verwendet darüber hinaus eine falsche Grammatik. Er lässt die Figuren sonderbare Sätze sprechen und erfindet – wie Stalin bemerkt haben soll – einen Kauderwelsch, der für den Leser eine große Herausforderung darstellt und den Text fast unübersetzbar macht.
Irgendwann einmal blickt einer der Protagonisten, der arme Herumtreiber Woschtschew, mit dessen Entlassung wegen Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit der Roman beginnt, hoffnungslos nachts zum Himmel, erblickt die Sternenversammlung im Zentrum der Milchstraße und fragt sich, wann wohl dort eine Resolution verabschiedet wird zur Abschaffung der Ewigkeit der Zeit und zur Entgeltung der Qual des Lebens.
Der Roman geht unter die Haut, er ist ungeheuerlich. Eine schärfere, unerbittlichere Abrechnung mit dem Stalinismus und den katastrophalen Folgen des Ersten Fünfjahresplanes für die Jahre 1928 bis 1933 wurde nie geschrieben. Die Neuübersetzung stammt von Gabriele Leupold, die außerdem einen umfangreichen Anhang mit Texterläuterungen zur Sprache und den politischen Ereignissen der Zeit besorgt hat.
(Januar 2017)
Über den gelungenen Neu- und Erweiterungsbau des Landesmuseums in Münster hatte ich schon vor zwei Jahren berichtet. Jetzt hat das Museum in Zusammenarbeit mit der Tate London Henry Moore eine umfangreiche Werkschau gewidmet. Der Engländer gewann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges internationales Ansehen und war dreißig Jahre lang führender Künstler für Großplastiken im öffentlichen Raum. In Deutschland nahm er viermal an der documenta in Kassel teil und fand früh Eingang in deutsche Museen. In seinen Werken hat er drei Themen beständig variiert: die liegende, die sitzende und die stehende Figur. Dabei nahm er seinen Weg von der figürlichen Form zur Abstraktion mit Abstechern in den Surrealismus. In Münster werden 120 Arbeiten (Skulpturen, Plastiken und Zeichnungen) von ihm und 16 weiteren Künstlern – z. B. Arp, Baumeister, Beuys, Giacometti, Hartung, Heiliger, Kricke und Picasso – präsentiert. Die Arbeiten stammen aus allen Schaffensperioden und zeigen beispielhaft seinen Weg in die Abstraktion. Raum 1 und 2 sind seinen liegenden Figuren gewidmet, Raum 3 Masken, Helmen und Köpfen, Raum 4 sitzenden Figuren, Raum 5 und 6 Abstraktionen. Besonders gut lässt sich seine Entwicklung an der Plastik der Liegenden verfolgen, zu der als Vorläufer die Zeichnungen liegender Frauen in U-Bahn-Tunneln, die in London als Luftschutzkeller benutzt wurden, gezeigt werden, die Shelter Drawings, die in den Jahren 1940 und 1941 entstanden. Sind in der erste Plastik noch die Körperformen ausgebildet und die Gesichtszüge deutlich zu erkennen, verschwinden sie in den abstrakten Wiederholungen, in weiteren Ausführungen verliert die Plastik ihre Mitte und wird in zwei Teile geteilt, wodurch eine Werkgruppe entsteht.
Wer sich nach dem Besuch der Sonderausstellung die Zeit nimmt, die ständige Sammlung anzusehen, dürften von der Qualität und dem Umfang überrascht werden. Nicht nur ist der deutsche Expressionismus exzellent vertreten, auch bei alten Meistern der Spätgotik und Renaissance sind Schätze zu entdecken. So hat das Museum ein halbes Dutzend Gemälde von Derick Baegert aus Wesel versammelt, der zu den wichtigsten Vertretern der niederrheinischen Malerei der Spätgotik gehört. Er ist heute kaum bekannt, weil nur ein kleiner Teil seines Werks die Zeitläufte überstanden hat, vermutlich wurde vieles in den Bilderstürmen zerstört. Ein anderer Höhepunkt der Sammlung sind Werke der Malerfamilie tom Ring. Sie stammte aus Münster und hat dort in der Mitte des 16. Jahrhunderts gewirkt. Von den im Landesmuseum gezeigten Werken ist vor allem das Familienbild des Grafen Rietberg bemerkenswert.
Auch außerhalb des Landesmuseums wird Kunst angeboten. Nur wenige Schritte entfernt hat ein Picasso-Museum seinen Platz gefunden und lädt zur Zeit zu einer Sonderausstellung mit Grafiken und Zeichnungen von Henri Matisse und Pablo Picasso ein. Die größte Überraschung der Ausstellung sind Kostüme, die Matisse für eine Opernaufführung von Puccinis Turandot geschaffen hat.
Schließlich sei auch noch auf das Lack-Museum mit über 2000 Exponaten aus Fernost, Arabien und Europa verwiesen.
(Dezember 2016)
Die Bosch-Ausstellung aus s-Hertogenbosch ist weitergezogen und nach Madrid in den Prado gewandert. Gezeigt wird dort eine um die Madrider Bestände erweiterte Schau, also mit dem Garten der Lüste und der Anbetung der Heiligen Drei Könige. Außerdem konnte aus Lissabon Die Versuchung des heiligen Antonius ausgeliehen werden, sodass von den großen Triptychen nur das Wiener Jüngste Gericht fehlt. Eine vergleichbare Werkauswahl wird sich so schnell nicht noch einmal zusammenführen lassen.
Das Unterlinden-Museum in Colmar, das schon lange über Platzmangel klagte, wurde umgebaut und hat zusätzlich einen Erweiterungsbau erhalten, der von dem Schweizer Architekturbüro Herzog & Meuron geplant und durchgeführt wurde. Durch die Einbeziehung einer ehemaligen Badeanstalt und eines Bauernhofs konnte die Ausstellungsfläche wesentlich vergrößert werden. So hat Martin Schongauer einen eigenen Raum erhalten, und jetzt werden auch Teile der Sammlung des 19. Und 20. Jahrhundert gezeigt. Die Museumserweiterung und die Neugestaltung des Platzes vor dem Museum werden allgemein sehr gelobt.
In Berlin zeigt die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen im Kulturforum unter dem Titel El Siglo de Oro. Die Ära Velasquez spanische Malerei des 17. Jahrhunderts mit mehr als einhundertdreißig Kunstwerken: Gemälden, Zeichnungen und Arbeiten der Bildhauerei. Neben dem Königshaus, das die Malerei als Werkzeug zur Selbstdarstellung nutzte, war die katholische Kirche wichtiger Auftraggeber, wodurch viele religiöse Bilder entstanden sind. Entsprechend sind in der Ausstellung alle großen Namen der Epoche vertreten.
Während man das Jahrhundert durchaus als goldenes Zeitalter der spanischen Malerei bezeichnen kann, trifft das für die politische, soziale und wirtschaftliche Lage des Landes nicht zu. Das 17. Jahrhundert war eher ein dunkles Zeitalter. Trotz der Gold- und Silberladungen aus den ausgebeuteten Kolonien ging Spanien mehrmals in Bankrott und verlor seine Großmachtstellung. Viele Kriege verzehrten das Geld, und der einfachen Bevölkerung ging es schlecht. Dieser Niedergang des Landes spiegelt sich in der Kunst: Die Gemälde sind düster, die Menschen zeigen kein Lächeln und keine Fröhlichkeit, vielmehr Schmerz, Niedergeschlagenheit oder Verzückung. Oft blicken die dargestellten Personen zum Himmel oder nur ins Leere.
Unter dem Titel Parkomanie würdigt die Bundeskunsthalle in Bonn die Gartenlandschaften des Fürsten Pückler in Muskau, Babelsberg und Branitz. In einer höchst gelungenen Kombination werden Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Luftaufnahmen, Flugsequenzen und 3D-Simulationen gezeigt. Man erfährt viel über den Fürsten, seine Pläne, seinen Lebenstraum, die Zerstörungen als Folge des Weltkriegs und den geglückten Wiederaufbau. Zusätzlich wurde der Dachgarten der Bundeskunsthalle nach den Regeln Pücklers bepflanzt. Dort begegnet der Besucher u. a. Zitronenbäumchen aus Spanien und Bäumen, die aus Muskau und Branitz nach Bonn gebracht und mit Kränen auf das Dach gehievt wurden.
In Lüttich wurde ein im klassizistischen Stil für die Weltausstellung 1905 erbautes Palais mit großem Aufwand zum Museum der schönen Künste umgestaltet und mit einem Anbau einer großen, vollständig verglasten Halle, deren Decke von schlanken Säulen getragen wird, elegant erweitert. Das Gebäude verfügt über zwei Ausstellungsetagen; während das Hochparterre Wechselausstellungen vorbehalten bleibt, ist die ständige Sammlung im Untergeschoss untergebracht. Das Museum liegt sehr schön im Boverie-Park auf einer Insel zwischen der Maas und einem Kanal und in geringer Entfernung von dem futuristischen, von Santiago Calatrava erbauten TGV-Bahnhof Guillemins, den man sich bei einem Besuch von Lüttich unbedingt ansehen sollte.
Eröffnet wurde das Museum mit einer Sonderausstellung unter dem Titel En Plein Air über Freiluftmalerei seit dem 18. Jahrhundert mit Leihgaben aus dem Louvre Paris, was eine Zeitung anlässlich einer Besprechung zu dem Titel „Ein Louvre in Lüttich“ veranlasste. Die Euphorie ist jedoch ziemlich übertrieben. Zwar gehören zu den präsentierten Werken Bilder von Vernet, Corot, Monet, Cézanne, Dufy, Friesz, Utrillo, Matisse, Léger und Picasso; aber es handelt sich nicht unbedingt um Spitzenwerke, und ich werde wahrscheinlich nur ein großformatiges Bild von Léger in Erinnerung behalten. Die überwiegende Zahl der ausgestellten Bilder stammt von kaum bekannten Künstlern, darunter ein riesiges, aus einem Dutzend oder mehr Einzeltafeln bestehendes Panorama von Konstantinopel aus dem Jahr 1818 und ein modernes, in kühlen blaugrünen Farben gehaltenes Gegenstück zum Motiv der „Einschiffung nach Kythera“ mit dem Titel „Landung auf Kythera“. Auf dem Bild sieht man zwei Personen auf einem felsigen Strand vor dem Meer, aber kein Schiff. Gemalt wurde es 1999 von Vincent Bioulès.
Übrigens war die schöne Halle weitgehend leer, und man fragt sich, wie sie für Ausstellungen benutzt werden kann. Für Gemälde ist sie auf jeden Fall nicht geeignet.
Der Kunstpalast in Düsseldorf hat seine Sommerausstellung dem Schweizer Jean Tingeley gewidmet. Mit großem Aufwand wurden Installationen und Riesenmaschinen nach Düsseldorf gebracht und neu aufgebaut. Auf der Internetseite des Museums kann man in einem Zeitraffervideo den Aufbau der großen Meta-Maxi-Utopia-Installation verfolgen, der über 15 Tage benötigte
Zusammengekommen ist eine wunderbare Hommage an die Sinnlosigkeit und den menschlichen Spieltrieb mit ironischen Seitenhieben auf die Entstehung von Kunst. Besonders schön der Tanz der Lumpen und die Malmaschine, die Mitte der 50er in Paris bei den Vertretern abstrakter Malerei für Empörung sorgte. Einen ganz anderen Tingeley lernt man im letzten Raum der Ausstellung kennen. Dort ist sein Mengele-Altar zu sehen, für den er nur die verbrannten Reste eines vom Blitzschlag getroffenen Bauernhofs verwendete, in dem auch die Tiere jämmerlich zugrunde gingen.
Vor zehn Jahren machte das überregional wenig bekannte Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld Schlagzeilen, weil die Stadt für die Sanierung des Gebäudes das berühmte Gemälde „Das Parlamentsgebäude in London“ von Monet verkaufen wollte, vermutlich das wertvollste Werk der gesamten Sammlung des Museums. Nach heftigen Protesten machte die Stadt einen Rückzieher. Jetzt kann man nach einer sechsjähriger Schließungszeit, in der eine Generalsanierung vorgenommen wurde, Monets Bild und die Sammlung wieder betrachten.
Zur Wiedereröffnung zeigt das Museum unter dem Titel Das Abenteuer unserer Sammlung eine Querschnitt durch den sehr heterogen Bestand aus höchst unterschiedlichen Schenkungen, Stiftungen und Werkkomplexen.
Kornelimünster lockt nicht nur mit einem historischen Stadtkern und einer immer wieder umgebauten und erweiterten, teilweise fünfschiffigen Klosterkirche, sondern auch mit dem Kunsthaus NRW. In einem Rokoko-Palais aus dem 18. Jahrhundert wird die Kunstsammlung des Landes NRW aufbewahrt, deren Anfänge bis ins Jahr 1945 zurückreichen. Ziel war und ist die Förderung junger Künstler durch Erwerb ihrer Werke. Inzwischen umfasst die Sammlung über 4000 Kunstwerke, von denen eine Auswahl in sehr schönen Räumen (allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten) gezeigt wird. Zusätzlich beschäftigen sich Wechselausstellungen mit aktuellen Entwicklungen der Kunst in NRW. Zurzeit sind Werke der Förderpreisträger des Landes NRW der Jahre 2013-2015 ausgestellt.
Im Landschaftspark Duisburg-Nord läuft im Rahmen der Ruhrtriiinnale die Filminstallation Manifesto von Julian Rosefeldt mit Cate Blanchett. In der riesigen, abgedunkelten Halle der ehemaligen Kraftzentrale werden auf großen Videowänden gleichzeitig 13 Szenen gezeigt, in denen die Schauspielerin in verschiedenen Rollen auftritt, z. B. als Obdachlose, Börsenmaklerin, Punkerin, Trauerrednerin, Puppenspielerin oder Nachrichtensprecherin, und Monologe zur Kunst vorträgt. Die Texte stammen u. a. von Marx, Kandinsky, Taut, Appollinaire, Malewitsch, Breton und Fontana und sind als Beiheft in einer deutschen Fassung erhältlich. Cate Blanchett (Blue Jasmine, Babel usw) ist wie immer phänomenal, außergewöhnlich, einzigartig. Sehenswert!
Abschließend sei noch erwähnt, dass in London auch die Tate Modern einen Anbau erhalten hat, der von den Architekten Herzog & Meuron ausgeführt wurde. Wie in Colmar wird die Architektur sehr gelobt, sogar gepriesen. Die neue Hängung dagegen wird sehr umstritten beurteilt. Ohne sie gesehen zu haben, möchte ich kein Urteil dazu abgeben.
(Im August 2016)
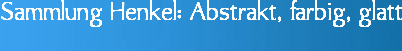
Seit 1970 sammelt Gabriele Henkel zeitgenössische Kunst und baute für das Unternehmen Henkel eine umfangreiche Kunstsammlung auf, die inzwischen mehrere Tausend Werke umfasst.
Nachdem bereits vor einigen Jahren bei DuMont eine zweibändige Ausgabe über die für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Sammlung erschienen ist (der erste Band zeigte Gemälde und andere Werke der Klassischen Moderne und der Kunst des 20. Jahrhunderts, der zweite Band Artefakte und Textilien aus verschiedenen Kontinenten), gibt jetzt die Kunstsammlung NRW im K 20 in Düsseldorf einen Einblick in die Sammlung. Gezeigt werden vierzig Werke, deren Auswahl und Hängung Gabriele Henkel selbst vorgenommen hat, sodass man davon ausgehen kann, dass es sich um Lieblingsbilder der Sammlerin handelt.
Da ich den Inhalt der beiden erwähnten Bände nicht kannte, hatte ich vor dem Besuch die Befürchtung, Frau Henkel gehöre zu den Sammlern, die – beraten von einem Kreis von Kunstexperten, Kunsthändlern und Galeristen – kaufen, was dem jeweiligen Zeitgeist entspricht, was als Investment die höchste Wertsteigerung erwarten lässt und was sich schließlich als Spekulationskollektion ohne Profil erweist.
Diese Befürchtung stellte sich als grundlos heraus. Wie die gut informierte Führerin beim Gang durch die Ausstellung erklärte, habe die Sammlerin von Anfang an das Ziel gehabt, die Kunstobjekte nicht fürs Depot zu kaufen, sondern mit den Bildern die Geschäftsräume, Büros, Flure und Treppenhäuser des Unternehmens in Holthausen auszustatten. Dazu habe sie die Frage gestellt, was passe zu Henkel, und drei Kriterien formuliert: die Malerei müsse abstrakt sein, sie müsse farbig sein und die Bildoberflächen müssten glatt wirken (weil dadurch eine Verbindung zu den Produkten des Unternehmens, den Wasch- und Reinigungsmitteln, hergestellt werden könne).
Die Düsseldorfer Ausstellung gliedert sich in vier Teile: in Werke der Klassischen Moderne, in abstrakte amerikanische Colourfield-Malerei, in Werke deutscher Künstler und (besonders überraschend) seltene Teppiche. In der Werkgruppe der Klassischen Moderne begegnet der Besucher Robert Delauny und u. a. Albert Gleizes, in der amerikanischen Gruppe überragt Frank Stella mit einem großformatigen Bild aus seiner persischen Serie (dieses Bild ist meiner Ansicht nach viel eindrucksvoller als sein Gegenstück im Museum Ludwig in Köln), deutsche Künstler sind durch Heinz Mack, Gerhard Richter und Günther Uecker gut vertreten.
Dass die Sammlerin durchaus bereit ist, von ihren Prinzipien abzuweichen, zeigt die Ausstellung mit einem schwarzen Nagelbild von Uecker und gegenständlichen Gemälden von Konrad Klapheck und Horst Münch.
Die Führerin ging detailliert auf einzelne Bilder ein und berichtete u. a., Frau Henkel sammle fast ausschließlich Werke männlicher Künstler, habe eine kleine Privatsammlung, die sie niemandem zeige, sei mit Frank Stella eng befreundet, der ihr bei der Auswahl amerikanischer Künstler helfe, und sei auch sonst in der Szene bestens vernetzt.
Wer sich nach dem Besuch über das Urteil der überregionalen Presse zur Qualität der ausgestellten Werke informieren will, findet aber … nichts. Bislang wurde die Ausstellung ignoriert.
(Im Juni 2016)
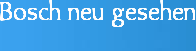
Über Hieronymus Bosch, sein Leben und sein Werk, wissen wir wenig. Wer sich damit beschäftigt, stößt auf viele Fragen, z. B.: Welche Vorbilder hatte er? Aus welchen Quellen schöpfte er seine phantastischen Erfindungen? In welcher Reihenfolge sind seine Gemälde entstanden? War er Mitglied eines Geheimbunds? Haben zwei Maler, ein älterer und ein jüngerer, seinen Namen benutzt?
Anlässlich des 500. Jahrestages seines Todes im August 1516 wurde im nordbrabantischen Museum seiner Heimatstadt ‘s-Hertogenbosch eine umfassende Werkschau mit 100 Ausstellungsobjekten (Gemälden, Zeichnungen und Buchillustrationen) zusammengestellt. In Vorbereitung dieser Retrospektive wurden in einem internationalen „Bosch Research Project“ zahlreiche Werke detailliert untersucht, teilweise restauriert und im Hinblick auf die Entstehungszeit neu bewertet. Bevor ich zu den teilweise überraschenden Beurteilungen komme, zunächst einige historische Anmerkungen.
Hieronymus Bosch wurde zwischen 1450 und 1453 geboren – dem Jahr, in dem die Osmanen Konstantinopel eroberten. Er hat sein ganzes Leben in ‘s-Hertogenbosch verbracht (über längere Reisen ist nichts bekannt) und starb auch dort. Zu seinen Lebzeiten blieb die Stadt von Kriegswirren verschont; sie gehörte zum Herzogtum Brabant, das 1430 an Burgund gefallen war und 50 Jahre später in den Besitz Habsburgs gelangte.
Wie es der Zufall will, gibt es einen berühmten Zeitgenossen, der fast identische Lebensdaten aufweist: Leonardo da Vinci; er lebte von 1452 bis 1519. Aber im Hinblick auf die Bildthemen und die Malweise kann man sich schwerlich einen größeren Unterschied vorstellen als den zwischen Bosch und Leonardo da Vinci. Auch die Schaffung der wesentlichen Werke verlief zeitbezogen völlig unterschiedlich. Während Leonardo bereits in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts zahlreiche Meisterwerke gemalt hatte (z.B. „Die Dame mit dem Hermelin“, „Die Madonna mit der Nelke“ und die erste Fassung der „Madonna in der Felsengrotte“), entstanden die Hauptwerke Boschs in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten. Hingegen ähneln sich die beiden in ihrer ungewöhnlichen Kreativität, die sich bei Leonardo in seinen vielen erfindungsreichen Zeichnungen von Maschinen und Vorrichtungen (z. B. einem Unterseeboot und einem Fallschirm) zeigte und bei Bosch in seinen phantastischen Mischwesen und Dämonen. Diese Kunst lässt sich nicht aus seinem Leben ableiten, und die Biographie, die die Entstehungsbedingungen seiner Visionen erklärt, wurde noch nicht geschrieben und wird sich vermutlich nie schreiben lassen. Was die Kunstströmungen der Zeit betrifft, lag ‘s-Hertogenbosch im Abseits. Die Kunstzentren waren im Westen Brabants und in Flandern Gent, Antwerpen, Brüssel, Tournai und Lille. Aber selbst wenn Bosch dort ausgebildet worden wäre, hätte er keinen Lehrer gehabt, dessen Werke ihm als Vorbild für seine Themen hätten dienen können. Auch das Research-Projekt ermittelte keine neuen Erkenntnisse zu den Quellen seiner phantastischen Erfindungen, sondern veränderte nur einige Zuschreibungen und Annahmen zu Entstehungszeiten einzelner Gemälde.
Bosch wird oft als ein noch dem mittelalterlichen Denken verhafteter Maler eingestuft, aber das Gegenteil trifft zu. Er hat die starren Regeln der Scholastik nicht mehr befolgt, sondern sie aufgebrochen, verfremdet und ironisiert – was man an vielen Bilddetails erkennen kann, z. B. an dem kleinen Dämon mit Brille auf dem Bild „Johannes auf Patmos“ oder an den Ereignissen in der Hintergrundlandschaft der „Anbetung der heiligen drei Könige“ (Fassung Madrid), die die Weltlandschaften Patinirs vorwegnehmen.
Das erhaltene Gesamtwerk Boschs umfasst 60-70 Gemälde, von denen der Kunsthistorikers Charles de Tolnay 35 als Originale anerkannte, 10 für Kopien verlorener Originale hielt und weitere 15 für umstritten erklärte. Eine italienische Werkmonographie aus einer Reihe des Rizzoli-Verlags enthält 70 Gemälde, von denen 37 als Originale anerkannt werden, und zählt 70 weitere Werke auf, die nur in Urkunden erwähnt wurden, wobei Doppelnennungen aber nicht auszuschließen sind.
Eine besondere Schwierigkeit der Bosch-Forschung war und ist die Festlegung der Entstehungszeiten der einzelnen Werke, weil Bosch nie mit einer Jahreszahl signiert hat und weil mit einer Ausnahme (der Bestellung eines „Jüngsten Gerichts“ von Philipp dem Schönen, dem Vater Karls V., im Jahr 1504) keine schriftlichen Dokumente vorhanden sind. Das Problem der Entstehungszeiten möchte ich am Beispiel der fünf großen Triptychen darlegen. Tolnay konnte nur stilkritische Überlegungen anstellen und nahm an, „Der Heuwagen“ sei 1495 oder früher entstanden, „Die Versuchung des heiligen Antonius“ (Fassung Lissabon) danach, aber auch noch vor dem Jahr 1500, „Das Jüngste Gericht“ (Fassung Wien) noch vor dem „Garten der Lüste“ und „Die Anbetung der heiligen drei Könige“ (Fassung Madrid) sei ein Alterswerk. Das Research-Projekt kommt auf der Grundlage der Untersuchung des Alters der Holztafeln zu einer ganz anderen Reihenfolge. Danach ist „Die Anbetung der heiligen drei Könige“ (Fassung Madrid) das älteste Werk und entstand zwischen 1490 und 1500; anschließend entstanden „Der Garten der Lüste“ zwischen 1495 und 1505, „Das Jüngste Gericht“ (Fassung Wien) zwischen 1500 und 1505, „Die Versuchung des heiligen Antonius“ (Fassung Lissabon) vor 1510, „Der Heuwagen“ aber erst zwischen 1510 und 1516!
Diese sensationell zu nennende Neubewertung scheint am deutschen Feuilleton vorbeigegangen zu sein. So gibt Benedikt Erenz in seiner Besprechung der Ausstellung in der Zeit vom 21.2.2016 immer noch 1490 als Entstehungsjahr des „Heuwagens“ an.
In der bis Anfang Mai laufenden Ausstellung werden 20 Originale gezeigt, wovon fünf Neuzuschreibungen des Research-Projektes sind. Von den großen Triptychen ist leider nur „Der Heuwagen“ zu sehen und vom „Garten der Lüste“ eine Kopie. Gegliedert ist die Hängung nach Themengruppen, die ich als etwas verwirrend empfand. Dagegen ist der Einsatz mehrerer Monitore, die Einzelheiten und Details der Bilder zeigen, sehr hilfreich und kann nur zur Nachahmung empfohlen werden. Auf die Rätsel über einen zweiten, jüngeren Maler, den sogenannten Meister M und über die wenig wahrscheinliche Mitgliedschaft Boschs in einem häretischen Geheimbund lässt sich der Ausstellungskatalog nicht ein, dagegen wartet er noch mit der Überraschung auf, das wunderbare Fragment eines Jüngsten Gerichts aus der Alten Pinakothek in München sei von einem Bosch-Nachfolger erst zwischen 1530 und 1540 gemalt worden. Was ich stilkritisch gar nicht nachvollziehen kann, weil die Farbigkeit sehr an die „Kreuztragung“ aus Gent erinnert und die gemalten Dämonen von derart hoher Qualität sind, dass man von diesem „Nachfolger“ noch andere Werke kennen müsste.
Wie dem auch sei … die Ausstellung wandert im Sommer nach Madrid, wo sie in veränderter Form gezeigt wird, u. a. mit dem Original des „Gartens der Lüste“ und mit der „Versuchung des heiligen Antonius“, die aus Lissabon ausgeliehen werden konnte.
Abschließend sei bemerkt, dass jeder, der die Ausstellung in ‘s-Hertogenbosch besucht, im Anschluss noch einen ungewöhnlichen Spaziergang über das Dach der Johannes-Kathedrale unternehmen kann, wo man viele Skulpturen von Menschen, Tieren und Dämonen auf den Strebebögen aus größter Nähe betrachten kann.
(Im April 2016)

Nein, keine neue Version der bekannten Geschichte aus dem Alten Testament über die Früchte vom Baum der Erkenntnis. Auch von den goldenen Äpfeln der Aphrodite, mit denen Hippomenes Atalante im Wettlauf besiegte und worüber Guido Reni ein großartiges Gemälde schuf, das heute im Prado hängt, soll nicht die Rede sein. Hier geht es um einen anderen Apfel. Den, aus dessen Wurf der größte zusammenhängende Erzählstrang der griechischen Mythologie entstehen sollte. Aber der Reihe nach: Zur Hochzeit von Peleus mit Thetis waren alle Götter geladen. Es war eine merkwürdige Hochzeit zwischen einer Göttin und einem Sterblichen, eine Vorsorgemaßnahme sozusagen, von Zeus selbst eingefädelt. Er hatte nämlich ein Auge auf Thetis geworfen, eine Nereide und Enkelin der Göttin Gaia, war aber vor dem Vollzug gewarnt worden: Thetis werde einen Sohn zur Welt bringen, der stärker werde als sein Vater. Diese Warnung der Themis ließ ihn Abstand von einer Affäre nehmen. Als Kandidat (oder Substitut) war Peleus verfügbar, der eine bewegte Vergangenheit aufzuweisen hatte. Er hatte seinen Halbbruder umgebracht, seine erste Frau verloren, musste zweimal von einem König entsühnt werden und hatte sich auch schon in einem Ringkampf mit Atalante versucht, aber verloren. Thetis hatte er in einer Höhle schlafend angetroffen und musste lange mit ihr kämpfen, bevor sie ihm zu Willen war. Eine andere, schönere Version ihrer ersten Begegnung dichtete Catull. Bei ihm (im Gedicht Carmen 64) war Peleus einer der Argonauten, begleitete Jason auf der Fahrt nach Kolchis und erblickte die Meernymphe Thetis im Schaum der Wogen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ihrem gemeinsamen Sohn gaben sie den Namen Achill. (In seinem raffiniert verschachtelten Gedicht preist Catull die späteren Heldentaten Achills im Trojanischen Krieg, verschweigt aber dessen frühen Tod.)
Auf der Hochzeitsfeier ging es – will man dem Gemälde von Joachim Wtewael aus dem Jahr 1612 Glauben schenken – zunächst sehr ausgelassen zu. Götter und Satyrn sind schon leicht angetrunken, nur Apoll, Herakles und Poseidon betrachten das Gelage aus der Distanz, und in der Mitte des Bildes erblickt man einen schon ziemlich mitgenommenen, alt aussehenden Peleus, der seine nackte Braut befummelt, während sie mit abwesendem Blick in den Himmel starrt. Alle Götter waren anwesend. Mit einer Ausnahmen: Eris, die Göttin der Zwietracht, war nicht eingeladen worden. Sie kam aber doch (auf dem Gemälde sieht man sie unter dunklen Gewitterwolken heranfliegen), um die Schmach zu rächen, und warf einen goldenen Apfel unter die Hochzeitsgesellschaft, auf dem die Worte eingeritzt waren: „Der Schönsten.“ Sogleich begannen Hera, Athene und Aphrodite sich um diesen Apfel zu streiten, bis Hermes sie im Auftrag des Zeus, der keine Lust hatte, den Streit zu schlichten, zu Paris führte, der die Wahl treffen sollte. Er hörte sich die Angebote der Damen an und entschied zugunsten der Aphrodite, weil sie ihm die schönste Frau der Welt als Bettgefährtin versprochen hatte. Was daraus wurde, ist allgemein bekannt …
Kürzlich nun stieß ich bei Durchsicht der ins Internet gestellten Bilder der Harvard Art Museums in Cambridge (USA) auf ein Gemälde "Urteil des Paris", als dessen Maler "Der Meister der Argonauten-Tafeln" genannt wurde. Beim Betrachten des Hintergrundes des Bildes und der kahlen, spitzen Berge glaubt man, ein Bild der Spätgotik vor sich zu haben. Auch die Aufteilung des Bildes im Vordergrund in zwei chronologisch erzählte Szenen mit jeweils vier Personen, die Trennung der Szenen durch einen Baum, die strenge Haltung der Figuren und die gesamte Formensprache lassen einen an Spätgotik/Frührenaissance denken. In der linken Gruppe fordern die drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite Zeus auf, den goldenen Apfel der Eris der Schönsten unter ihnen zu geben. Zeus aber drückt sich und verweist mit der Hand auf den Sterblichen Paris, der solle die Wahl treffen ... In der rechten Gruppe scheint der etwas dümmlich dreinsehende Paris sein Urteil bereits getroffen zu haben.
Beim Betrachten der Kleidung und der Kopfbedeckungen kommen Zweifel über die zeitliche Einordnung auf: Ist das noch Spätgotik, oder handelt es sich um ein später gemaltes Bild, das auf spätgotische Motive zurückgreift? Die Kopfbedeckungen sind ein Kapitel für sich. Traditionell wurde nur Pallas Athene mit einem Helm dargestellt. Auf dem Gemälde trägt die Göttin links außen eine äußerst merkwürdige Kopfbedeckung. Nach dem ersten Eindruck könnte es sich um kleine Drachenflügel handeln, die sie sich ins Haar geflochten hat, aber es müsste eigentlich ein Helm sein, wie ihn die berühmte Pallas Athene des Phidias getragen haben soll und wie ihn die sogenannte Varvakeion-Athena trägt (und der mit dem bekannteren griechischen Helm mit Rosshaarbündeln keine Ähnlichkeit hat). Eine andere Göttin trägt einen Hut mit Krempe und ist wahrscheinlich Hera, weil Farbe und Musterung dem Helm von Zeus entsprechen. Bei den Kopfbedeckungen scheint dem Maler übrigens ein Missverständnis unterlaufen zu sein, er hat offenbar Athene mit Aphrodite verwechselt: Im rechten Bild scheint Paris nämlich ausgerechnet der Göttin mit den Drachenflügeln den Apfel überreichen zu wollen.
Da mir dieses Gemälde außerordentlich originell erschien, habe ich nach dem Meister der Argonauten-Tafeln gesucht und bin im MET New York fündig geworden. Dort wird als Maler dieser Tafeln ein Biagio d'Antonio genannt, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Florenz gearbeitet haben soll. Dagegen wird wiederum in anderen Quellen ein Jacopo del Sellaio als Meister der Argonauten-Tafeln genannt.
War Biagio d'Antonio tatsächlich der Schöpfer, dürfte "Das Urteil des Paris" um oder vor 1475 gemalt worden sein und wäre zu einer Zeit entstanden, als Leonardo seine bezaubernde Verkündigung malte. Unabhängig von der genauen Entstehungszeit dürfte dieses Urteil des Paris die älteste im Abendland gemalte Fassung der berühmten Geschichte sein, die später zigmal gemalt worden ist (von Cranach über Rubens bis zur Moderne). Übrigens handelt sich um eine der wenigen Fassungen, in denen der Maler der Versuchung widerstand, die Göttinnen sich dem Sterblichen nackt präsentieren zu lassen! Kaum zu glauben, dass dieses schöne Bild keine Vorbilder hat - zumindest sind mir keine bekannt.
Bei der Suche nach weiteren Bildern zu dem Thema bin ich im Katalog der Berliner Botticelli-Ausstellung des vergangenen Jahres auf ein mir bis dahin nicht bekanntes "Urteil des Paris" gestoßen, das normalerweise in Venedig an einem dem Publikum nicht zugänglichen Platz hängt. Die Abbildung des großformatigen Gemäldes (80 x 200 cm) erstreckte sich über zwei Seiten und ließ viele Einzelheiten erkennen. Nach dem Begleittext soll es in der Zeit zwischen 1483-88 entstanden sein und die Handschrift mehrerer Maler enthalten, die auch fremde Motive (z. B. ein Schiff im Vordergrund) verwendet haben. Botticelli war nicht beteiligt, man kann das Bild wegen der hölzernen, steifen Figuren höchstens als Werkstattarbeit einstufen.
Sehr viel eleganter hat sich Wtewael 1615 des Themas angenommen, wobei er den Trick anwandte, im Hintergrund die Hochzeit von Peleus und Thetis samt heranfliegender Eris zu wiederholen. Er besaß eine große Könnerschaft in der Darstellung anmutiger Frauen, und auf seinem Bild ist Athena mit Abstand die Schönste der drei Göttinnen, die mit liebenswürdigem Lächeln zusieht, wie Paris den Apfel Aphrodite reicht, als freue sie sich, nicht erwählt worden zu sein. Was für ein Jammer, dass dieser großartige Spätmanierist aus Utrecht in Deutschland so gut wie unbekannt ist.
(Im März 2016)
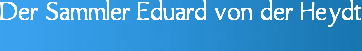
Nach Umbau und Neueröffnung widmete das Museum Folkwang in Essen im Jahr 2010 seine erste große Sonderausstellung seiner Geschichte vor 1933 und präsentierte eine Rekonstruktion der Sammlung, die von Karl Ernst Osthoff 1902 begonnen und nach seinem Tod 1921 von den Erben nach Essen verkauft worden war. Vielleicht brachte der Publikumserfolg dieser Ausstellung die Kuratoren des Wuppertaler Von der Heydt-Museums auf die Idee, mit einer vergleichbaren Ausstellung die Bedeutung der Bankiersfamilie Von der Heydt für die Entwicklung der Sammlung herauszustellen und erneut zu würdigen. Bereits im Jahr 2002 hatte das Museum nämlich zu seinem hundertjährigen Jubiläum eine kleinere Ausstellung über die Sammler August und Eduard Von der Heydt präsentiert. Vielleicht sollte aber auch mit der neuerlichen Würdigung ein Schlussstrich unter die Kontroversen aus den Jahren 2002 bis 2008 gezogen werden, als man das Museum und einen Kulturpreis wegen unterstellter, aber nicht belegter Verstrickungen Eduard Von der Heydts in nationalsozialistische Verbrechen umbenennen wollte.
Einzelheiten der Museumsgeschichte mit den herben Verlusten im Nationalsozialismus (darunter Picassos Gemälde „Akrobat und Harlekin“) und die Schenkungen vor allem Eduard von der Heydts sind bei Wikipedia detailliert dargestellt, so dass ich sie hier nicht aufzuzählen brauche. (Auch über die Kontroversen findet man im Internet leicht weitergehende Informationen.) Heute verfügt das Museum über 3000 Gemälde von der niederländischen Malerei im 17. Jahrhundert bis zur abstrakten Kunst nach dem zweiten Weltkrieg, wobei Impressionismus, Expressionismus und die zwanziger Jahre die Schwerpunkte darstellen.
Besonders interessant an der Ausstellung ist die chronologische Aufbereitung des Materials. Die Ausstellung folgt über die verschiedenen Räume hinweg den Lebensstationen Eduard von der Heydts von Wuppertal über Amsterdam und Berlin nach Ascona, wo er ein großzügiges Heim für seine Kunstwerke schuf – neben den Gemälden auch Skulpturen und Kultfiguren. Er hatte nämlich schon in den zwanziger Jahren begonnen, zusätzlich ostasiatische (chinesische und indische) und afrikanische Kunst zu sammeln. 1937 wurde er schweizer Staatsbürger und übergab seine ostasiatische Sammlung der Stadt Zürich als Grundstock für das Museum Rietberg, setzte aber nach dem Krieg seine Schenkungen an das Museum in Wuppertal fort.
Aus der Zusammenarbeit mit dem Museum Rietberg ist jetzt in Wuppertal eine sehenswerte Ausstellung entstanden. Meiner Ansicht nach die beste seit der Ausstellung „Der Sturm“ im Jahr 2012.
(Im Febr. 2016)
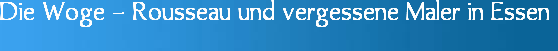
Wie auf die Wogenkämme des Meeres tiefe Täler folgen, so lösen sich in der Kunstgeschichte Phasen der Begeisterung für einen Maler, eine Stilrichtung oder eine Epoche mit mitunter tiefen Tälern des Vergessens ab. Beispielsweise war In den 60er und 70er Jahren Friedrich Schröder-Sonnenstern ein Star. Erinnern Sie sich noch an die phantastischen Bildtitel wie „Der Mondschützenkönig“ oder „Der Alkohol des Kaki zähmt den Mondesel“? Auch Ivan Generalić war ein Star. Heute sind beide so gut wie vergessen.
Unter dem Titel „Der Schatten der Avantgarde – Rousseau und die vergessenen Meister“ hat jetzt das Museum Folkwang in Essen eine Ausstellung vergessener naiver Maler zusammengestellt. Gezeigt werden laut Begleitheft Werke von 13 Künstlern, die überwiegend keine akademische Ausbildung hatten und heute nicht im Museumsbetrieb zu finden sind. So ganz stimmt das nicht, denn den Mittelpunkt der Ausstellung bilden Gemälde von Henri Rousseau, dessen Hauptwerke schon seit langem im Musée d’ Orsay, im Museum of Modern Art und im Guggenheim beheimatet sind.
Geschickt wurde die Ausstellung in einzelne Räume gegliedert, die jeweils einem Künstler gewidmet sind und etwa ein halbes Dutzend Werke zeigen. Von Rousseau z. B. sind mehrere Dschungelbilder und das bekannte Porträt des Schriftstellers Pierre Loti mit rotem Fez ausgestellt, aber leider nicht „Die Schlangenbeschwörerin“, „Der Traum“, „Der Löwe mit schlafender Zigeunerin“ oder „Die Ballspieler“.
Besonders beeindruckend fand ich den Raum mit den Blumengemälden von Séraphine (Louis), während ich bei anderen Künstlern doch Zweifel habe, ob der Titel „vergessener Meister“ gerechtfertigt ist. Vergleicht man die für die Essener Ausstellung ausgewählten Künstler mit dem 1959 bei DuMont erschienenen Standardwerk über naive Malerei von Oto Bihalji-Merin, stellt man fest, dass dort, abgesehen von Rousseau, nur Bauchant, Hirshfield, Seraphine, Trillhaase und Wallis berücksichtigt wurden. Die Essener Kuratoren haben offensichtlich einen amerikanischen Schwerpunkt gesetzt und dafür z. B. auf die naive Malerei des früheren Jugoslawien verzichtet.
Zwischen die Werke der vergessenen Künstler wurden in Essen Gemälde berühmter Maler wie Gustave Courbet, Honoré Daumier, Paul Gauguin, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Fernand Léger, Pablo Picasso, Robert Delaunay, Piet Mondrian, Emil Nolde und Paula-Modersohn-Becker gehängt, um Bezüge herzustellen, die mir nicht immer nachvollziehbar waren. Dass z. B. (wie es im Beiheft heißt) das ziemlich unbekannte Bild von Max Ernst aus dem Jahr1920 „Der Kaiser von Wahaua“ eine zentrale künstlerische Strategie der Avantgarde des 20. Jahrhunderts vorführe, nämlich die Aneignung und Neukombination fremden Bildmaterials auch von Autodidakten, war mir während des Besuchs vollkommen entgangen und wurde bei der Führung auch nicht näher erwähnt. Nachgefragt hatte ich bei dem Bild von Giorgio de Chirico (einer Variante seiner leeren Piazza-Gemälde) und die Antwort erhalten, dieses Bild habe einen Bezug zu dem ausgestellten Gemälde von Max Ernst. Da ich aber zu diesem Zeitpunkt den „Kaiser von Wahaua“ noch nicht entdeckt hatte, hatte ich keinen Ansatz für eine weitere Frage zur Aufhellung des Sachverhalts.
Übrigens war von Gustave Courbet das Gemälde „Die Woge“ als Vorbild für naive Seestücke ausgestellt, aber wahrscheinlich nicht als Sinnbild für das ewige Auf und Ab der Wertungen im Kunstbetrieb.
(Im Jan. 2016)
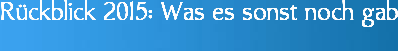
Da ich eine besondere Vorliebe für die Malerei des Manierismus habe, war für mich die Einzelausstellung über den Spätmanieristen Joachim Wtewael besonders interessant. Der Künstler lebte von 1566 bis 1638 und malte hauptsächlich mythologische Themen. Sein Stil erinnert an Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger und Giorgio Vasari. Die Ausstellung lief unter dem Titel Pleasure and Piety – the Art of Joachim Wtewael zunächst in seiner Heimatstadt Utrecht und wanderte dann nach Washington und Houston. Die Ausstellung umfasste ca. 50 Werke, darunter seine vielleicht bekanntesten Gemälde „Perseus befreit Andromeda“ aus dem Louvre in Paris und „Das Urteil des Paris“ aus der National Gallery in London. In deutschen Museen hängen übrigens drei Bilder von ihm: „Die Sintflut“ in Nürnberg, eine Fassung der „Hochzeit von Peleus und Thetis“ in Braunschweig und eine „Küchenszene“ in Berlin. Schöner Katalog!
Bei einem Besuch einer Ausstellung mit Werken von Günther Uecker in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf im Frühjahr versuchte ich, auf einem typischen Bild die Anzahl der eingeschlagenen Nägel abzuschätzen. Dazu zählte ich die Nägel einer horizontalen und einer vertikalen Reihe und kam auf jeweils hundert Nägel. Insgesamt hatte der Künstler demnach für dieses Werk ca. zehntausend Nägel verwendet. Mir ist nicht bekannt, wie viele Nagelbilder Uecker im Lauf seines Lebens geschaffen hat. Falls es hundert waren, dürfte er mindestens eine Million Nägel eingeschlagen haben
Während eines verlängerten Wochenendes in Brüssel das Magritte-Haus besucht, ein puppenstubenkleines Reihenhaus mit zwei Stockwerken in einem nördlichen Vorort. Jahrelang lebte Magritte mit seiner Frau in zwei Zimmern im Erdgeschoss und einer Kammer im Dachgeschoss, in das sie eine Badewanne gestellt hatten, während das Obergeschoss mit ebenfalls nur zwei Räumen von einer anderen Familie bewohnt wurde. Im Erdgeschoss lag das Wohnzimmer zur Straße, das Schlafzimmer daneben hatte sein Fenster zum schmalen Garten hinter dem Haus. Das Wohnzimmer war blau gestrichen und besaß einen Kamin, den Magritte als Vorlage für sein Bild „La Durée poignardée“ (das Gemälde mit der Spielzeuglokomotive) aus dem Jahr 1939 benutzt hat. Beim Rundgang fallen noch weitere aus seinen Gemälden bekannte Motive auf. Zum Garten hin gibt es eine winzige Küche, deren Erweiterung Magritte mit dem Verkaufserlös eines Gemäldes von Max Ernst, das ihm Breton geschenkt hatte, finanzierte.
Bei dem Brüssel-Besuch auch am Palais Stoclet vorbeigefahren, diesem Jugendstil-Gesamtkunstwerk, das von dem Architekten Joseph Hoffmann zwischen 1905 und 1911 im Stil der Wiener Secession erbaut wurde, sich noch immer in Privatbesitz befindet und für Publikum nicht zugänglich ist. Berühmt ist die Villa auch für den von Gustav Klimt geschaffenen Wandfries im Speisesaal des Hauses. Die wenigen im Lauf der Jahrzehnte eingelassenen Besucher schwärmten von der Schönheit der gesamten Innenausstattung des Hauses. Sollten die Erben sich einmal über einen Verkauf einigen, erhält Brüssel eine weitere Kunstsensation.
Unter dem Titel Gemalte Verführung zeigt das Wallraf-Richartz-Museum in Köln 80 Gemälde des flämischen Malers Godfried Schalcken aus der Zeit zwischen 1680 bis 1700. Der heute kaum bekannte Künstler ging bei Gerard Dou in die Lehre, bei dem er ein detailversessenes „schönes Malen“ lernte. Er hat mit minutiöser Sorgfalt viele kleinformatige Porträts, liebenswerte Genreszenen, mythologische und biblische Themen und nächtliche, nur von Kerzen beleuchtete Szenen geschaffen, wie er sie bei seinem Lehrmeister lernte und wie man sie sonst nur von Georges de la Tour kennt. Ob Schalcken in seinen Bildern die Qualität seines Lehrmeisters erreicht oder sogar übertroffen hat, lässt sich allerdings ohne einen unmittelbaren Vergleich von Originalen nicht beantworten. Trotzdem: Die Ausstellung ist sehenswert und läuft noch bis Ende Januar 2016.
Auch in Köln hat das Römisch Germanische Museum bis Ende März 2016 unter dem Titel Agrippina – Kaiserin aus Köln eine kleine Sonderausstellung über Agrippina die Jüngere zusammengestellt. Agrippina gilt als Kölner Stadtmutter, sie war eine Urenkelin des Augustus und die Mutter von Nero. Zur 2000sten Wiederkehr ihres Geburtstages gelang es dem Museum, die Teile einer überlebensgroßen Statue der Kaiserin, die schon in der Antike in viele Teile zerschlagen worden war, mit dem Kopf, der sich sonst in Kopenhagen befindet, zu vereinen. Auch sehr sehenswert.
Vor einem Jahr war 2015 im Museum Folkwang in Essen die Schau „Monet, Gauguin, van Gogh … Inspiration Japan“ zu sehen. Sie beschäftigte sich mit der Bildästhetik und Formensprache japanischer Kunst sowie deren künstlerischen Rezeption in Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Werken von Degas, Gauguin, van Gogh und Monet sowie den Mitgliedern der Nabis: Bonnard, Denis, Ranson, Vallotton und Vuillard.
Jetzt läuft in der Bundeskunsthalle in Bonn bis Ende Februar 2016 wie eine Spiegelung oder ein Gegenstück der Essener Ausstellung unter dem Titel Japans Liebe zum Impressionismus. Von Monet bis Renoir eine Zusammenstellung von Werke von Impressionisten aus Beständen japanischer Sammler. Präsentiert werden rund 100 in Europa meist unbekannte Werke. Außerdem werden eindrucksvolle Werke japanischer Maler gezeigt, die um 1900 die europäischen Ideen aufgriffen und eine moderne, westlich inspirierte japanische Kunst begründeten.
Das Städel Museum Frankfurt hat sich zu seinem 200. Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht. Für die Jubiläumsausstellung bis Ende Januar 2016 konnten 40 Gemälde aus renommierten Museen ausgeliehen werden, die mit eigenen, herausragenden Werken des Museums in einen Dialog der Meisterwerke treten sollen. Zu den Jubiläumsgästen gehören unter anderem Jan van Eyck, Johannes Vermeer, Nicolas Poussin, Edgar Degas, Pablo Picasso und Franz Marc. Die Gegenüberstellungen – beispielsweise das posthume Porträt der „Simonetta Vespucci“ aus der Botticelli-Werkstatt mit einem Frauenporträt von Dante Gabriel Rossetti; Rembrandts „Blendung des Samson“ mit Artemisia Gentileschis „Judith und Holofernes“; das „Katzenkonzert“ von David Teniers dem Jüngeren mit dem Fragment „Vier tanzende Ratten“ von Ferdinand von Kessel – erlauben, die Sammlungsgeschichte des Städel zu hinterfragen und überraschende kunstgeschichtliche Bezüge herzustellen. (Ziemlich albern ist allerdings der wohl in letzter Minute erdachte Zusatztitel: Stars treffen Stars.)
Vermutlich vollkommen unabhängig voneinander haben die Bielefelder Kunsthalle und die Schirn Kunsthalle in Frankfurt sich des Themas Malerinnen im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts angenommen und dazu Ausstellungen konzipiert. In Bielefeld trägt die Ausstellung den Titel Die Moderne der Frauen in Deutschland und zeigt unbekannte Bilder aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. In Frankfurt läuft die Ausstellung unter dem Titel Sturm-Frauen. Künstlerinnen der Avantgarde in Berlin 1910 bis 1932. Diese Zusammenstellung greift das Thema der Ausstellung „Der Sturm. Zentrum der Avantgarde“ im Von der Heydt-Museum Wuppertal aus dem Jahr 2012 auf, beschränkt sich allerdings auf den weiblichen Beitrag zur Entwicklung der Moderne. Sonia Delaunay, Natalja Gontscharowa, Else Lasker-Schüler, Gabriele Münter und Marianne von Werefkin gehören zu den Malerinnen, die bis Anfang Februar 2016 zu sehen sind. Die rund 280 Werke aus den Stilrichtungen des Expressionismus, des Futurismus, des Dadaismus, des Konstruktivismus und der Neuen Sachlichkeit stammen von vielen internationalen Leihgebern, z. B. dem Centre Pompidou, dem Guggenheim Museum und dem MoMA, der Tate und dem Theater Museum in St. Petersburg sowie der Berlinischen Galerie.
Und schließlich seien noch erwähnt: Die Botticelli-Renaissance in der Berliner Gemäldegalerie, The World of Tim Burton im Max Ernst Museum in Brühl, Ornament and Illusion. Carlo Crivelli im Isabella Stewart Gardner Museum in Boston und New Objectivity: Modern German Art in the Weimar Republic 1919-1933, im LACMA (Los Angeles County Museum of Art), die erste Ausstellung in den USA über die Kunst der neuen Sachlichkeit.
(Im Dezember 2015)

Lange habe ich um die Malerei des 18. Jahrhunderts einen großen Bogen geschlagen, mit dem französischen und venezianischen Rokoko konnte ich wenig anfangen, Bouchers rosa Nackte fand ich grässlich. Die einzige Ausnahme war Goya, dessen vielschichtiges Werk mich schon früh sehr beeindruckt hatte. Breschen in die Mauer meine Abneigung schlugen eine Ausstellung der Gemälde Fragonard 1988 in New York und 1996 eine Ausstellung über Magnasco in Mailand. Erst danach habe ich mich mit den Facetten des vernachlässigten Jahrhunderts näher beschäftigt.
Jetzt (im Herbst 2015 bis zum Januar 2016) wird im Grand Palais in Paris das Werk von Elisabeth Vigée-Lebrun mit einer großen Ausstellung gewürdigt. Sie wurde 1755 in Paris geboren – im selben Jahr, in dem Marie Antoinette in Wien als fünfzehntes Kind der Kaiserin Maria Theresia zur Welt kam. Wie Angelika Kauffmann und Anna Dorothea Therbusch war Elisabeth Vigée-Lebrun Tochter eines Porträtmalers und zeichnete schon sehr früh. Als ihr Vater starb, war sie erst 12 Jahre alt, konnte aber mit ihren Porträts bald zum Familienunterhalt beitragen. Mit Porträts ihres Bruders und ihrer Mutter, die sie im Alter von 14 Jahren malte, machte sie die Pariser Gesellschaft auf sich aufmerksam und erhielt trotz fehlender Ausbildung viele Aufträge. Zu den Besonderheiten ihrer Technik gehörten Gemälde auf Holz als Untergrund, wodurch Transparenz der Farben und Glanzeffekte auf Haut und Stoffen erzielt wurden.
Eine ihrer Förderinnen war die Herzogin von Orleans, die sie eines Tages der Königin vorstellte. Marie Antoinette war keine ausgesprochene Schönheit, sie hatte als Erbe der Habsburger eine dicke Unterlippe, ein vorgeschobenes großes Kinn und leicht vorstehende Augen mitbekommen. Ihre Mutter Maria Theresia hatte sich immer beklagt, dass die Gemälde sie unvorteilhaft darstellten. Elisabeth Vigée-Lebrun gelang es, die Realität zu überdecken, und machte die Königin schöner als sie war, aber ohne die Ähnlichkeit aufzugeben. Bald gehörte die Malerin zum engeren Kreis der Königin und konnte sie ohne Sitzungen porträtieren.
Wegen ihrer Nähe zum Hof verließ die Künstlerin nach Ausbruch der Revolution 1789 Paris. Ihr Exil sollte zwölf Jahre dauern. Es brachte sie nach Rom, Wien und schließlich nach Sankt Petersburg. Erst 1802 konnte sie nach Paris zurückkehren.
Elisabeth Vigée-Lebrun ist 87 Jahre alt geworden, hat über sechshundert Porträts gemalt und im hohen Alter noch ihre Memoiren geschrieben. Aber schon mit dem 1782 gemalten „Selbstbildnis mit Strohhut“ hat sie Unsterblichkeit erlangt.
Anlässlich der Vorbereitung der Ausstellung im Grand Palais entstand ein Doku-Drama über das Leben der Künstlerin, das im Oktober von artetv ausgestrahlt wurde.
(Nov. 2015)
Nach einem schweren Seesturm, dessen Gewalt den Meeresboden aufgewühlt hatte, stießen im Jahr 1900 Schwammtaucher vor der kleinen griechischen Insel Antikythera, die nordwestlichen von Kreta liegt, auf ein Schiffswrack und begannen mit der Bergung der Ladung. Nach den ersten Funden stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein aus der Antike stammendes Schiff handeln musste, ein Handelsschiff von dreißig Meter Länge mit einer äußerst interessanten, kostbaren Ladung von griechischen Marmorskulpturen, Bronzestatuen, Amphoren und Möbeln. Aus der Fracht und den an Bord gefunden Münzen aus Pergamon und Ephesus zog man den Schluss, dass das Schiff etwa im Jahr 60 vor Chr. gesunken und auf dem Weg von Delos ins westliche Mittelmeer unterwegs gewesen sein muss. Möglicherweise war der Schiffsherr ein Kunsthändler auf dem Weg nach Rom. In jenen Jahren hatten nämlich reiche Römer begonnen, griechische Originale oder griechische Kopien älterer Werke zu kaufen. Von Cicero ist beispielsweise ein Brief an einen Freund in Athen erhalten, in dem er ihn um die Übersendung von Kunstwerken für seine Villa bittet.
Neben den teilweise zerfressenen Marmorstatuen und zerbrochenen Bronzen fand man einen merkwürdigen Klumpen zusammengebackener Holz- und Metallteile in der Größe einer Schuhschachtel. Trotz der Muschelkalkverkrustungen konnte man Bruchstücke einer Inschrift und Teile von Zahnrädern erkennen. Die ersten Wissenschaftler, die sich mit dem merkwürdigen Ding beschäftigten, kamen zu der Ansicht, es handele sich um ein Astrolabium (ein astronomisches Instrument zum Ablesen der Position von Sternen an einem bestimmten Datum). Aber im Lauf der Jahre und nach vielen weiteren Untersuchungen einschließlich einiger Durchleuchtungen des inzwischen in viele Teile zerbrochenen Geräts hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir eine komplexe Kalendermaschine vor uns haben.
Über diesen Mechanismus von Antikythera habe ich zum ersten Mal vor etwa zehn Jahren einen Zeitungsartikel gelesen, war sehr fasziniert und habe mir darum auch vor drei Jahren einen Dokumentarfilm angesehen, der bei artetv lief und den aktuellen Stand der Forschung zeigte. Das Gerät bestand ursprünglich aus vermutlich 70 unterschiedlich großen Zahnrädern und mehreren verstellbaren Skalen. Die Skalen zeigten den Sonnen- und Mondkalender, einen Kalender der Mond- und Sonnenfinsternisse sowie der olympischen Spiele. Weitere Einzelheiten und umfangreiche Informationen über die verschiedenen Funktionen der antiken Kalendermaschine kann man bei wikipedia unter dem Stichwort „Mechanismus von Antikythera“ nachlesen.
Am meisten war ich von der Darstellung des Meton-Zyklus beeindruckt, der das große Sonnenjahr mit 19 Sonnenjahren beziehungsweise 235 Mondmonaten umfasst. Für diesen Zyklus hat der Handwerker, der das Gerät baute, ein großes Zahnrad mit 235 exakt ausgestanzten Zacken geschaffen. Der Zyklus war schon den Babyloniern bekannt und Grundlage ihres Mondkalenders. Meton gehörte im fünften Jahrhundert v. Chr. zu den ersten griechischen Astronomen, die diesen Zyklus für einen astronomischen Vorhersagekalender und zum Beispiel für die Festlegung der Sommersonnenwende verwendeten.
Jetzt ist im Antikenmuseum in Basel eine Ausstellung unter dem Namen „Der versunkene Schatz“ bis Ende März 2016 zu sehen. Zum ersten Mal werden Fundstücke aus dem Schiffswrack außerhalb Griechenlands gezeigt, die Teile der Kalendermaschine durften dagegen das Archäologische Nationalmuseum in Athen nicht verlassen. Dafür kann man aber drei komplette Nachbauten bestaunen.
Der Kalendermechanismus von Antikythera ist ein wundervolles Beispiel für menschliche Wissbegier und handwerkliche Kunstfertigkeit aus einer Epoche, der man die dafür notwendigen technischen Fähigkeiten nicht zugetraut hatte. Gleichzeitig übermittelt der Klumpen aus Holz und Metall eine ziemlich erschreckende Botschaft. Er zeigt, wie schnell kulturelle und wissenschaftliche Leistungen aus dem Gedächtnis der Menschen getilgt werden können, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen.
Niemand weiß, wer die Maschine entworfen und dabei vermutlich auf Beobachtungen und Aufzeichnungen von mehreren hundert Jahren zurückgegriffen hat. War es Archimedes oder einer der griechischen Astronomen? Wo ist das Gerät entstanden? War es einzigartig oder die Kopie eines älteren Vorbildes? Hat ein Handwerker die Kalendermaschine geschaffen oder hatte er eine Werkstatt? Vom Winde verweht …
(Okt. 2015)
Wer im Benrather Schlosspark von Norden kommend den Spiegelweiher entlanggeht und nach etwa zweihundert Metern links abbiegt, stößt auf ein langgestrecktes, gelb verputztes Gebäude, das allgemein unter dem Namen Orangerie bekannt ist. Dieses Gebäude ist der erhaltene Rest des alten Benrather Schlosses, das hier nach 1650 errichtet worden war und schon einhundert Jahre später dem neuen Schloss weichen musste.
Zum besseren Verständnis der Geschichte des alten Schlosses ein kurzer Überblick über den historischen Hintergrund: Nach einem Erbstreit fiel das Herzogtum Jülich-Berg (und damit das rechtsrheinische Gebiet von Königswinter bis Angermund) 1614 an die Wittelsbacher Herzöge von Pfalz-Neuburg. Da Jülich-Berg größer und bedeutsamer als Neuburg an der Donau war, nahmen die Herzöge während des Dreißigjährigen Krieges 1636 ihren Hauptsitz in Düsseldorf. Fünfzig Jahre später erbten sie erneut, diesmal die Kurpfalz und verlegten 1718 ihre Residenz erst nach Heidelberg, dann nach Mannheim und schließlich nach München, wodurch Jülich-Berg immer mehr zu einem aus der Ferne regierten Nebenland wurde.
Unter dem Titel „SehensWert“ läuft jetzt im Schlossmuseum bis Ende November 2015 eine Ausstellung zur Planungs- und Baugeschichte der Benrather Schlösser, in der auch das alte Schloss ausführlich gewürdigt wird.
Die heutige Orangerie war der Nordflügel des Wirtschaftshofes, dessen Südflügel und ein beide verbindender Arkadenbau vor hundert Jahren abgerissen wurden. Das eigentliche Schloss lag westlich des Wirtschaftshofes und ersetzte eine ältere Wasserburg, die ihrerseits bereits ein Nachfolgebau einer vermutlich im 12. Jahrhundert errichteten Burg der Herren von Benroide war.
Der Neubau als Wasserschloss mit einer Gartenanlage begann wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, einer Zeit, in der das Heilige Römische Reich Deutscher Nation darniederlag, und kann als eines der ersten Landschlösser der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angesehen werden. Über sein Äußeres können wir uns dank mehrerer Zeichnungen und Gemälde des frühen 18. Jahrhunderts, die in der Ausstellung zu sehen sind, ein gutes Bild machen. Die Bilder zeigen das Schloss von Süden, von Norden und vom östlichen Wirtschaftshof. Man erkennt, dass der Architekt auf die traditionelle Bewehrung verzichtet und ein fast quadratisches Gebäude im italienischen Landhausstil mit einer Doppelturmfassade errichtet hatte, die an die Villa Medici in Rom erinnert. Über die Innenausstattung, zu der eine Gemäldesammlung gehört haben soll, wissen wir nur wenig. Dagegen konnte der nördlich der Orangerie angelegte Garten in den letzten Jahren rekonstruiert werden.
Die Ausstellung enthält auch Gemälde der Erbauer, des Herzogs und späteren Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz und seiner zweiten Gemahlin Elisabeth Amalie Magdalena von der Pfalz, Tochter des Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Obwohl sie siebzehn Kinder hatte, trieb sie das Bauprojekt des Wasserschlosses energisch voran und drückte ihm ihren Stempel auf. Der in Düsseldorf so populäre Kurfürst Jan Wellem war übrigens ihr ältester Sohn, und mit geschickter Heiratspolitik schuf sie verwandtschaftliche Beziehungen in halb Europa: Eine ihrer Töchter wurde Gattin des österreichischen Kaisers, eine andere Königin von Spanien.
Höhepunkt einer Führung für den Freundeskreis des Instituts für Kunstgeschichte war die Besichtigung von drei sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Räumen in der Orangerie mit Prunkkaminen, Stuckdecken und Fresken mythologischer Themen. Den Grund für diese Ausstattung von Räumen des Wirtschaftshofes kann man sich heute schlecht erklären, vielleicht waren Verzögerungen beim Bau des eigentlichen Schlossgebäudes der Anlass. Am besten erhalten ist der sogenannte Artemissaal mit einer großartigen Stuckdecke und fünf Deckenfresken, wovon zwei Artemis (Diana) und zwei Aphrodite (Venus) zeigen. Nach dem Urteil von Prof. Schweizer, der uns führte, existiert im Umkreis von 200 km kein vergleichbarer Raum.
In einem anschließenden Raum befindet sich über dem Kamin ein Fresko von Amor und Psyche. Ihre Geschichte hat übrigens keinen uralten mythologischen Hintergrund, sondern ist ein Kunstmärchen des römischen Schriftstellers Apuleius, das er in seinen Roman „Der goldene Esel“ eingeschoben hat. Venus, eifersüchtig auf die Schönheit der Königstochter Psyche, beauftragt ihren Sohn Amor, Psyche zu erniedrigen. Der verliebt sich jedoch in das Mädchen und entführt es in seinen Palast, wo er sich seiner Gefangenen nur nachts nähert, damit seine Mutter nichts merkt. Eindringlich ermahnt er Psyche, sich nicht verleiten zu lassen, zu versuchen, herauszufinden, wer er sei. Eines Nachts nähert sie sich jedoch ihrem Geliebten mit einer Öllampe. Amor fühlt sich betrogen und fliegt davon.
Szenen aus der Geschichte von Amor und Psyche wurden in der Kunst häufig dargestellt. Besonders berühmt ist die Skulptur „Die Umarmung“ von Antonio Canova. Das Fresko über dem Kamin in Benrath zeigt den Augenblick, in dem Psyche im Schein der Lampe den schlafenden Amor betrachtet, und erinnert in der Ausführung an ein spätmanieristisches Gemälde von Jacopo Zucchi, das in Rom in der Villa Borghese hängt.
(Im Sept. 2015)
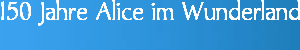
Vor 150 Jahren, im Sommer 1865 veröffentlichte der Mathematikdozent am Trinity College in Oxford, Charles Dodgson, unter seinem Künstlernamen Lewis Carroll eine Geschichte mit dem Titel „Alices Abenteuer unter der Erde“, die später als „Alice im Wunderland“ berühmt wurde und heute als Klassiker der Weltliteratur gilt. Das Besondere an der Geschichte ist ihre vertrackte Mischung aus chaotischem Nonsens, satirischer Auflehnung gegen Regeln und dem Spiel mit der Logik, durch die sie sich ihrer viktorianischen Zeitbezogenheit entledigt hat und auch heute noch neue Interpretationen und Verwandlungen zulässt. Nach dem Tagebucheintrag von Charles Dodgson sind die Abenteuer von Alice am vierten Juli 1862 während einer Bootsfahrt auf der Themse entstanden. Begleiter auf dem Boot waren die zehnjährige Alice Liddell und ihre beiden Schwestern, denen er zur Unterhaltung aus dem Stegreif eine Geschichte über ein Mädchen, das bei der Verfolgung eines weißen Kaninchens in ein Erdloch fällt, erzählt hatte, und am Abend musste er Alice versprechen, ihr die Geschichte aufzuschreiben. Es dauerte bis Weihnachten 1864, dann lag sie in einer handgeschriebenen Fassung und mit eigenen Zeichnungen geschmückt auf dem Gabentisch bei den Liddells. Die Buchausgabe im folgenden Jahr hatte einen erweiterten Textumfang und enthielt Illustrationen von John Tenniel, der durch seine Arbeiten für die Satirezeitschrift „Punch“ ziemlich bekannt war. Das Buch wurde vom Publikum begeistert aufgenommen, bis heute wiederholt für die Bühne bearbeitet, etwa zwanzigmal verfilmt, häufig ins Fernsehen gebracht und immer wieder neu illustriert. Die aktuellste Bearbeitung ist ein Musical mit dem Namen „wonder.land“, das zur Zeit in Manchester läuft. Hier wurden die Abenteuer für das Internet-Zeitalter aufbereitet, und aus Alice ist Aly geworden, ein Mischling in zerrütteten Verhältnissen. Aus der tristen Gegenwart ihrer Sozialwohnung fällt sie in eine virtuelle Welt, wo sie sich in Gestalt ihres Avatars als blonde Alice eine neue Identität zulegt.
Ich habe die Abenteuer von Alice zuerst im Kino kennengelernt, im Zeichentrickfilm von Walt Disney aus dem Jahr 1951, und die Nonsens-Episoden vom Hutmacher und der verrückten Teegesellschaft, der Lachkatze und der rauchenden Raupe haben sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Gelesen habe ich sie erst Jahre später in einer Übersetzung von Christian Enzensberger. Die Ausgabe des Insel-Verlages enthielt auch die Zeichnungen des Autors sowie die Fortsetzung „Alice hinter den Spiegeln“. Wieder einige Jahre später kaufte ich noch drei illustrierte Ausgaben: Alice im Wunderland mit Illustrationen von Anthony Browne im Lappan Verlag, „Alice Through the Looking Glass“ mit den Illustrationen von John Tenniel und eine Ausgabe des Zinnober Verlags mit beiden Teilen, illustriert von Ralph Steadman.
Liest man aktuelle Kommentare zu Alice im Wunderland, geht es meistens nicht mehr um die Abenteuer unter der Erde und auch nicht um die durchaus interessante Frage, ob nicht das Thema der eigenen Identität der eigentliche Kern der Geschichte ist (Wer bist denn du? fragt die Raupe Alice), sondern um den eigenartigen, scheuen, exzentrischen Charles Dodgson und die Natur seiner Beziehung zu kleinen Mädchen. Liest man dagegen ältere Texte dazu, beispielsweise das Nachwort von Christian Enzensberger aus dem Jahr 1963 oder die Anmerkungen von Helmut Gernsheim in seinem Buch „Lewis Carroll Photographer“ aus dem Jahr 1969, fällt auf, dass dort diese Problematik übergangen oder nur beiläufig angedeutet wurde. Auch als Dieter E. Zimmer im Jahr 1980 in der ZEIT für die Reihe „100 Bücher“ Alice im Wunderland beschrieb, fand er nur harmlose Worte: „Carroll wirbt um die Zuneigung eines heranwachsenden Mädchens, das zu lieben ihm verboten ist.“
Nähern wir uns dem Thema daher mit einigen Fakten: Dodgson war zwanzig Jahre älter als Alice Liddell. Er hatte keine Beziehung mit erwachsenen Frauen gehabt, als er im Alter von dreißig Jahren die Geschichte vom Wunderland erfand. Er hatte später die Absicht, Alice Liddell zu heiraten, wurde aber von ihren Eltern zurückgewiesen – vermutlich nicht wegen des Altersunterschiedes, sondern wegen seiner mangelnden beruflichen Perspektiven. Er hat über viele Jahre ein Tagebuch geschrieben, aber die Eintragungen vom Mai 1858 bis zum Mai 1862 wurden später von seinem Neffen vernichtet. Er hat sich intensiv mit Fotografie beschäftigt, wie andere bürgerliche Zeitgenossen Fotos gesammelt und in der Zeit von 1856 bis 1880 regelmäßig Aufnahmen gemacht. Wegen eines skandalösen Ereignisses, dessen Inhalt nie ans Tageslicht kam, hörte er 1880 unvermittelt mit dem Fotografieren auf. Nach seinem Tod wurden aus seinem Nachlass dreiunddreißig Alben zum Kauf angeboten, wovon etwa zehn seine eigenen Aufnahmen enthielten. Er hat Erwachsene fotografiert und junge Mädchen. Angesehene Bürger von Oxford und London (darunter Künstler wie Millais und Rossetti, Dichter wie Tennyson, Männer der Kirche, Professoren und sogar den jüngsten Sohn der Königin Victoria). Junge Mädchen (aber keine Knaben) in normaler Kleidung, in Kostümen (z. B. als Chinesin) und auch nackt. Wie wir heute wissen, war schon damals im prüden England der Handel mit Aktfotos erwachsener Frauen und junger Mädchen ein blühendes Geschäft, zumal die Gesetze junge Mädchen kaum schützten. Dazu aus einem englischen Band aus dem Jahr 1973 über „Victorian Erotic Photography“ ein Zitat zur Gesetzgebung im Jahr 1885: “The day after a girl has completed her thirteenth year she is perfectly free to dispose of her person to the first purchaser.” In dem Buch befindet sich an einer anderen Stelle folgende Beschreibung einer Nacktaufnahme eines siebenjährigen Mädchens: “Her secret charms are completely devoid of hair as nature has not yet given her the revolting token of the puberty.“
Bei den Aufnahmen, die Dodgson von jungen Mädchen machte, sollen immer ihre Mütter anwesend gewesen sein, und die erwachsene Alice (die verheiratete Mrs. Reginald Hargreaves) sagte später: „Fotografiert zu werden, war für uns ein Vergnügen und keine Buße.“ Aber woher wissen wir, ob sie die Wahrheit sprach? Ob es sich bei der Beziehung zwischen Dodgson und Alice nur um Freundschaft oder eine verstörende (zwangsneurotische?) Lolita-Geschichte oder um (wie es ein Klappentext behauptet) die einzige große Liebe seines Lebens handelte, wird uns wohl für immer verschlossen bleiben.
(Im August 2015)

Die Engländer bezeichnen Gebäude, die keinem erkennbaren Zweck dienen und manchmal schon als Ruine errichtet wurden, als Folly, als Verrücktheit. Die meisten dieser Follies entstanden im 18. Jahrhundert als Ende einer Sichtachse in neu angelegten Parks, als Blickfang in Landschaftsgärten oder als Folge der wiedererwachten Begeisterung für die Gotik. Eine der berühmtesten Follies war das Herrenhaus Fonthill Abbey in der Nähe von Salisbury. Es war kein schlossartiges Wohnhaus, sondern ein neugotisches Architekturtheater mit vier Flügeln und einem Turm von 90 m Höhe, der ursprünglich höher als der Vierungsturm der Kathedrale von Salisbury werden sollte, aber dreimal einstürzte und bei seinem dritten Einsturz auch große Teile des Herrenhauses zerstörte. Erbaut wurde Fonthill Abbey zwischen 1796 und 1813 von William Beckford, der als der reichste Bürger Englands galt (sein Vater hatte ein Vermögen mit Sklavenhandel und Baumwollplantagen gemacht) und schon vorher den Roman „Vathek“ geschrieben und anonym veröffentlicht hatte. „Vathek“ gilt neben dem „Castle of Otranto“ von Horace Walpole als wichtigstes Beispiel der gothic novel, des Schauerromans aus dem 18. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des Kalifen Vathek, der auf der Suche nach übernatürlichen Kräften und ekstatischen Genüssen in die Hölle hinabsteigt und dort für seine zügellosen Leidenschaften und Greueltaten bestraft wird. (Der Roman war in Deutschland lange unbekannt, und ich wurde nur durch eine Besprechung der ersten vollständigen Übersetzung im Insel-Verlag in den 60er Jahren auf ihn aufmerksam; auf Abbildungen von Fonthill Abbey und die Baugeschichte bin ich aber erst ein Jahrzehnt später bei der Planung einer Rundreise durch England und Schottland gestoßen. Versuche, die noch vorhandenen Reste zu besichtigen, scheiterten daran, dass die Zugangswege versperrt oder überwuchert waren.)
Als ich jetzt bei einem Tagesausflug ins Kröller-Müller-Museum im niederländischen Nationalpark Hoge Veluwe bei Otterlo das Jagdhaus Sint Hubertus erblickte, kam mir sogleich der schlanke Turm von Fonthill Abbey ins Gedächtnis. Aber der Reihe nach: Der Besuch im Kröller-Müller-Museum, das einen umfangreichen Bestand an Werken van Goghs besitzt (z. B. das schöne „Nachtcafé in Arles“), galt zunächst einer Sonderausstellung anlässlich seines 125. Todestages. Zum Gedenken wurden Gemälde aus dem Bestand mit Bildern von Vorläufern, Zeitgenossen und Nachfolgern in vier Themengruppen verglichen: Personen, Motive aus der Natur, Landschaften und Stillleben. Dazu wurden Gemälde von Bonvin, Toorop, Fantin-Latour, Corot, Cézanne u. a. herangezogen. Dieser Bildervergleich hielt meiner Ansicht nach viel weniger, als die Vorankündigung versprochen hatte. Glücklicherweise waren die Werke der ständigen Sammlung und der Bericht der Führerin über die Entstehung des Museums sehr viel interessanter. Das Unternehmen des Ehepaars Kröller-Müller (er war Holländer, sie war Deutsche) verdiente vor und während des Ersten Weltkrieges mit dem Handel von Roheisen und Stahl sehr viel Geld, das Helene Kröller-Müller benutzte, um Kunstwerke zu kaufen. Sie kaufte van Gogh, Redon, Seurat, Signac; ihre Sammlung wuchs so rasch, dass sie schon nach wenigen Jahren den Gedanken eines Museumsbaus fasste. Da ihr Mann ein leidenschaftlicher Jäger war und in kurzer Zeit ein 5.500 Hektar großes Gebiet an Wäldern, Heide- und Grasflächen sowie Sandlandschaften mit Lebensraum für Hirsche und Wildschweine als Jagdgebiet gekauft hatte, entstand der Plan, hier das Museum und ein Wohnhaus zu errichten. Die Geschichte der Entstehung beider Gebäude ist ziemlich verwickelt. Den ersten Entwurf für ein Wohnhaus mit Museum machte Peter Behrens, danach wurden Ludwig Mies van der Rohe und Hendrik Berlage beauftragt. Keiner der Museumsentwürfe wurde ausgeführt, stattdessen 1914 mit dem Bau eines Jagdhauses als Wohnhaus nach einem Entwurf von Berlage begonnen. Bedingt durch den Ersten Weltkrieg und die damit verbundene Materialknappheit aber erst 1920 fertiggestellt. 1919 wurde Henry van de Velde (der das Osthaus-Museum in Hagen vollendet hatte) mit einem neuen Museumsentwurf beauftragt, der auch nicht verwirklicht wurde, weil die Geschäfte des Unternehmens nicht mehr die dafür notwendigen Erträge brachten. 1935 wurden das Jagdhaus und das gesamte Gebiet der Hoge Veluwe in eine Stiftung überführt, während die Kunstsammlung der niederländische Staat erhielt. Diese Schenkung erfolgte unter der Bedingung, dass auf dem Gelände innerhalb von fünf Jahren ein Museum für die Kunstsammlung unter der Leitung des Architekten Henry van de Velde zu bauen sei.
Auch dieser Plan wurde nicht ausgeführt, stattdessen entstand in den Jahren 1937 bis 1938 als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Regierung ein Übergangsmuseum. Dieser schlichte lichtdurchflutete Bau, ein von van de Velde entworfenes Provisorium in Form eines T, ist bis heute Kern des Museums geblieben, beherbergt die Sammlung und fügt sich hervorragend und unauffällig in die Landschaft ein.
Die Sammlung, an die ich von einem lange zurückliegenden Besuch nur noch eine vage Erinnerung besaß, lohnt den Besuch. Unbedingt. Zu den Höhepunkten zählen neben dem schon erwähnten „Nachtcafé“ „Der Zyklop (Polyphem und Galatea)“ von Redon, „Le Chahut“ von Seurat, „Das blinde Haus“ von Degouve de Nuncques (ein Schlüsselwerk des Symbolismus und Vorlage für Magrittes berühmtes Bild: „Das Reich der Lichter“) und „Die Braut“ von Prikker. Helene Kröller-Müller muss einen exzellenten Geschmack besessen haben. Zum Museum gehört noch ein Skulpturengarten, und zum Park gehört noch das schon erwähnte Jagdhaus.
Von dem Jagdhaus hatte ich zuvor noch nie gehört, erwartete eine Art Forsthaus und war deshalb außerordentlich überrascht, als wir während eines Picknicks am Ufer eines, wie wir später erfuhren, künstlich angelegten Sees einen ersten Blick auf das am gegenüberliegende Ufer liegende Gebäude werfen konnten. Dass man es mit einem außergewöhnlichen Bau mit schönen Dachabstufungen zu tun hat, sieht man schon aus der Ferne, und die Besichtigung der Innenräume bestätigt und verstärkt den ersten Eindruck. Wir haben hier ein Gesamtkunstwerk vor uns (vielleicht sogar eines der wichtigsten Baudenkmale der Niederlande), bei dem die kleinsten Einzelheiten sorgfältig geplant waren und aufwendig ausgeführt wurden. Beispielsweise bestehen die Decken in den Räumen des Erdgeschosses aus Mustern farbig glasierter Backsteine. Geld spielte keine Rolle. Im Gegenteil: Nach Darstellung der Führerin wollte das Ehepaar Kröller-Müller mit dem Haus den eigenen Reichtum bewusst zur Schau stellen, und die Kosten des Hauses sollen (in heutige Währung umgerechnet) etwa 40 Millionen Euro betragen haben.
Aber warum gleicht das so gelobte Jagdhaus einer englischen Verrücktheit, einer Folly? Wegen des Turms. Zentral über der Dachlandschaft erhebt sich ein über dreißig Meter hoher Turm, der keine Funktion hat als die, Aufmerksamkeit zu erregen und Staunen hervorzurufen. Diesen Turm könnte man sich gut als Leuchtturm auf einer Klippe am Meer vorstellen. Aber ein im Ausguck des Turms stehender Betrachter sieht kein wogendes Meer mit Brandung und Gischt, kein Schiff in Not, keine mit dem Sturm kämpfenden Möven, sondern nur ein grünes Meer aus Baumwipfeln. Aber davon abgesehen (oder vielleicht deswegen) ist der Nationalpark Hoge Veluwe eine schöne Schatzkammer der Niederlande.
(Im Juli 2015)

Seit 1991 wird in jedem Sommer in Neuss ein Shakespeare-Festival durchgeführt, wobei in einem verkleinerten Nachbau des Londoner Globe-Theaters vier Wochen lang – meistens im Juni, manchmal auch bis in den Juli hinein – verschiedene Schauspieltruppen aus den unterschiedlichsten Ländern mit ihren aktuellen Einstudierungen auftreten. Da fast in jedem Jahr zehn bis zwölf Stücke vorgestellt wurden, dürften inzwischen fast 300 Inszenierungen gezeigt worden sein.
Das Besondere an dem Neusser Festival ist die Atmosphäre: In dem kleinen Theater mit 500 Plätzen sitzt man in drei Etagen eng gedrängt auf Holzbänken in einem Halbkreis vor der Bühne und erlebt das Geschehen aus nächster Nähe. Für großartige Kulissen ist kein Platz, was die Schauspieler zwingt, dem Publikum Ort und Zeit einer Szene mit einfachen Mittel glaubhaft zu machen. Ein geniales Beispiel war vor zwei Jahren in einer Aufführung von „Viel Lärm um Nichts“ zu sehen: Hero will ihre Freundin Beatrice mit einem Mann verkuppeln und lockt sie deshalb in einen Obstgarten mit einer Laube, wo sie gegenüber ihrer Kammerzofe die Vorzüge dieses Mannes preist und so tut, als wisse sie nichts von der Anwesenheit der Lauscherin. Statt den Garten mit ein paar eingetopften Bäumchen vorzutäuschen, spannten Hero und ihre Kammerzofe eine Wäscheleine quer über die Bühne, hingen Bettwäsche auf und nutzten den Schutz der Tücher, um sich lobpreisend über den Wunschkandidaten zu ergehen. Die besondere Atmosphäre bezieht sich auch auf die Umgebung des Theaters. Bei schönem Wetter sitzt man draußen, unterhält sich oder hört einer Einführung zu, die einer der Schauspieler vorträgt, während andere Schauspieler durch die Reihen gehen und das Programm anpreisen oder auch mal aktuelle Nachrichten verkünden wie z. B. „Im Fußballspiel Deutschlang gegen … steht es …“
Die ersten zwei Jahre des Festivals hatte ich verpasst, aber seit 1993 habe ich in jeder Saison zwei bis drei Aufführungen besucht. Meine erste Begegnung mit Shakespeare hatte ich freilich schon vor Jahrzehnten und zwar im Alter von acht oder neun Jahren, als meine Mutter mich aus welchen Gründen auch immer in eine Kinoaufführung der Hamlet-Verfilmung mit Laurence Olivier mitnahm. Der Geist des Vaters, der am Anfang plötzlich aus dem Nebel auf der Schlossmauer auftaucht und seinen Sohn mit düsterer Stimme zur Rache auffordert, steht noch immer vor meinen Augen, außerdem erinnere ich mich auch noch vage an die Fechtszene zwischen Hamlet und Claudius, habe aber den Rest des Films vergessen und vor allem an Jean Simmons als Ophelia keine Erinnerung mehr. Meine Bekanntschaft mit Shakespeare begann aber noch früher: Einer meiner größten Kindheitsschätze war nämlich ein Liebig-Album. (Zur Erklärung: Nach 1870 gab die Firma Liebig für ihren Fleisch-Extract Sammelbilder heraus, wobei jeweils 6 Bilder eine Serie bildeten. Die Serien behandelten ganz unterschiedliche Themen: z. B. fremde Länder, Sitten und Gebräuche, Trachten, Sprichwörter, Szenen aus der Geschichte, Schlösser, Städte, Naturereignisse, Tiere, Pflanzen, Märchen, Opern und auch Theaterstücke. Insgesamt sollen bis 1940 über 1000 Serien herausgebracht worden sein.) Das Album, das ich in unserem Speicher zwischen anderen alten Sachen fand, enthielt ca. 100 oft unvollständige Serien aus der Zeit um 1900. Sobald ich lesen konnte, nahm ich einzelne Bilder aus dem Einsteckalbum und las die Erläuterungen auf der Rückseite. Eine der Serien behandelte Hamlet.
Wann ich dort zum ersten Mal diesen Namen gelesen habe, weiß ich natürlich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war Hamlet das allererste Schauspiel, das ich gesehen habe. Danach bin ich Shakespeare während der Schulzeit weiter im Kino und auch im Radio begegnet. Ein paar Jahre später lief die Julius Cäsar-Verfilmung mit James Mason als Brutus und dem jungen Marlon Brando als Mark Anton, der die berühmte politische Trauerrede mit der ständigen Wiederholung hält: ... und Brutus ist ein ehrenwerter Mann! Wieder ein paar Jahre später (1957 oder 58) kam eine russische Fassung von Othello in die Kinos, im Radio hatte ich da schon „Timon von Athen“ und den „Sommernachtstraum“ als Hörspiel mit der Musik von Mendelssohn-Bartholdy erlebt. Den ersten Shakespeare-Stoff, den ich in einem richtigen Theater sah, war „Macbeth“ – allerdings als Verdi-Oper, die ich damals ziemlich langweilig fand. Im Lauf der Jahre habe ich andere Stücke von Shakespeare auf der Bühne oder als Verfilmung gesehen, und als das Neusser Festival begann, kannte ich die meisten Tragödien, aber nur wenige Komödien, deren Inhalte ich zudem häufig verwechselte.
In Neuss standen in den bisherigen 25 Jahren fast alle Stücke Shakespeares auf dem Spielplan, allerdings in höchst unterschiedlicher Häufigkeit. „Der Sommernachtstraum“, die Komödie „Was ihr wollt (bzw. die zwölfte Nacht)“ „Romeo und Julia“, „Macbeth“ und „Hamlet“, waren bislang die Spitzenreiter – keine schlechte Auswahl, um mit fünf Stücken die Spannweite Shakespeares zu zeigen. Merkwürdigerweise stand aber „König Lear“, obwohl eines des bedeutendsten Dramen, nur einmal auf dem Programm. Regelmäßig dagegen waren weitere Komödien zu sehen („Viel Lärm um nichts“ beispielsweise), und viele sonst selten inszenierte Stücke wie „Titus Andronicus“, „Perikles“, „Troilus und Cressida“ und „Coriolan“ gelangten mindestens einmal zur Aufführung.
Bislang nicht gezeigt wurden die drei Teile von „Heinrich VI.“, „Cymbeline“ und „Antonius und Kleopatra“ nur stark gekürzt zusammen mit „Julius Cäsar“ in einer Aufführung. Dass die drei Teile von Heinrich VI. noch nicht im Programm waren, ist nicht sehr bedauerlich. Sie haben einen Ruf als schwache Stücke (S. hat eine Reihe schwacher Stücke geschrieben: Entweder ist die Handlung mit heißer Nadel zusammengeheftet, oder es fehlt jede Charakterentwicklung: Heinrich VIII. gehört auch dazu.) Dass „Cymbeline“ und „Antonius und Kleopatra“ nicht gespielt wurden, finde ich dagegen bedauerlich, weil sie starke Frauenrollen enthalten: Imogen in „Cymbeline“ und Kleopatra. Letztere hält übrigens Harold Bloom in seiner umfassenden Betrachtung aller Stücke (Shakespeare – The Invention of the Human) für die subtilste und unergründlichste aller Frauenfiguren. Neben wortflinken Frauen ist die Parallelität oder Spiegelung der Handlung (was sich am Königs- oder Fürstenhof abspielt, wiederholt sich im Bürgertum oder beim Landvolk auf derber Art) oft besonders bemerkenswert, gut zu sehen beispielsweise im „Sommernachtsraum“ und bei „König Lear“ oder den Komödien „Was ihr wollt“ und „Verlorene Liebesmüh“.
Um den Spielplan zu bereichern und die Abwechslung zu erhöhen, werden in Neuss auch Stücke und Musikaufführungen von Zeitgenossen gezeigt. So standen schon „Schade, dass sie eine Hure ist“ von John Ford, „The Changeling“ von Thomas Middleton und im vergangenen Jahr zwei Stücke von Lope de Vega auf dem Programm.
Anfangs bildete die Bremer Shakespeare Company das Rückgrat des Festivals und war oft mit drei Inszenierungen vertreten, wobei sie stets das Prinzip anwandte, nur vier bis fünf Schauspieler einzusetzen, die dann mehrere Rollen spielen mussten. Dieses Verfahren kann in manchen Stücken sinnvoll sein (warum sollte die Schauspielerin, die im Sommernachtstraum die Elfenkönigin Titania spielt, nicht auch die Amazonenkönigin Hippolita darstellen?), aber in anderen Stücken führt die Methode oft zur Verwirrung der Zuschauer, wenn sie nicht mehr erkennen können, wer da gerade spricht. Außerdem führt diese Rollenreduktion zur Langweile, weil wir alle Abwechslung brauchen und die Augen gerne schweifen lassen. Den Unterschied konnte man in diesem Jahr am Vergleich von zwei Aufführungen besonders gut erkennen. „Maß für Maß“ wurde mit einer Minimalbesetzung von vier Schauspielern fast ohne Kostümwechsel gegeben, wobei die wenigen besonderen Effekte, die sich beständig wiederholten, bald verbraucht wirkten. Im Gegensatz dazu wurde in „Verlorene Liebsmüh“ eine Truppe von 14 Schauspielern aufgeboten, die über die kleine Bühne wirbelten, dass es ein großes Vergnügen war, ihrer Spiellust zuzusehen und ihren Wortgefechten zuzuhören.
In den letzten Jahren hat die englische Propeller Company, die nur mit Männern besetzt ist, besonders gelungene Inszenierungen nach Neuss gebracht: u. a. einen Sommernachtstraum, eine mexikanische „Komödie der Irrungen“ und eine fabelhafte „12th Night“, die beste von Shakespeares Komödien, in der ein Schauspieler eine Frau spielt, die sich als Mann verkleidet, in den sich gleichzeitig ein Mann und eine Frau verlieben, das Stück, in dem alle verrückt sind und nur der Narr bei Verstand …
Nachdrückliche Erinnerungen habe ich auch an eine Aufführung von „Troilus und Cressida“ durch die Ernst Busch Schauspielschule Berlin, deren Inszenierung auch ein Beispiel für gelungenen Rollenwechsel war. Bei diesem schwierigen Drama aus dem trojanischen Krieg ist die Szene abwechselnd in Troja und im Lager der Griechen. Eine Gruppe von fünf Schauspielern stellte entweder die trojanischen (Hektor, Paris, Äneas …) oder die griechischen Helden (Agamemnon, Achill, Odysseus …) dar. Um dem Publikum den Ort der nächsten Szene anzukündigen, stand eine Frau (die von der Kleidung und der Frisur her an Angela Merkel erinnerte) mit einer Schiefertafel am Rand der Bühne, schrieb mit Kreide auf die Tafel „Griechen“ oder „Trojaner“, zeigte sie dem Publikum und pfiff dann mit einer Trillerpfeife, worauf die Personen, die gerade auf der Bühne waren, verschwanden und leicht verwandelt als Griechen oder Trojaner wieder auftauchten.
Das Schlimmste am Neusser Festival ist der Kartenvorkauf. In jedem Jahr beginnt er an einen Samstag im Frühjahr um 9.00. Danach kann man die Karten entweder online oder über Telefon oder in einer Verkaufsstelle erwerben. Da inzwischen die regelmäßigen Besucher wissen, dass eine Stunde später kaum noch Karten vorhanden sind, stürzen alle um 9.00 an ihren Computer oder ans Telefon, was das Bestellsystem nicht bewältigt. Nachdem ich in den letzten Jahren schon mal eine Stunde lang vergeblich versucht hatte, in das System zu kommen, bin ich in diesem Jahr zu einer Verkaufsstelle in Neuss gefahren, war schon vor 8.00 dort und fand bereits eine kleine Schlange von einem Dutzend Personen vor. Als die Schlange eine halbe Stunde später auf ca. 50 oder mehr Personen angewachsen war, kam eine Angestellte aus dem Geschäft, sprach tröstende Worte und verteilte Minzplätzchen zur Stärkung. Beim Warten kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die auch seit Beginn des Festivals Aufführungen besucht hat und davon träumt, einmal alle Stücke einer Saison hintereinander zu sehen …
(Juni 2015)
Die Studienreise des Freundeskreises des Instituts für Kunstgeschichte an der HHU Düsseldorf führte 2015 nach Flandern und in den Louvre von Lens. Das historische Flandern musste im Lauf der Jahrhunderte viele Gebietsveränderungen mit wechselnden Herren erdulden und war am Ende des Mittelalters für einhundert Jahre sogar Teil des Herzogtums Burgund, bevor es an Habsburg fiel und im 16. Jahrhundert dann unglücklicherweise an Spanien. In der Epoche der burgundischen Herrschaft lebten die berühmten Maler Robert Campin, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden und Hugo van der Goes, die ihre Auftraggeber in den mit dem Tuchhandel reichgewordenen Städten fanden und deren Themen und Maltechniken unser Bild von der altniederländischen Malerei geprägt haben.
Die erste Hälfte der Studienreise galt den Städten Brügge und Gent, deren historische Stadtbilder und unvergleichliche Stadtsilhouetten allgemein bekannt sind und hier keiner weiteren Beschreibung bedürfen. Hingewiesen sei nur auf besondere Glanzpunkte: in Gent auf den Altar Jan van Eycks (der sich allerdings nicht mehr am ursprünglichen Platz in einer Seitenkapelle der St. Bavo-Kathedrale befindet, sondern mit Panzerglas gesichert unter dem Westturm) sowie auf das Gemälde „Die Kreuztragung“ von Hieronymus Bosch im nicht im Zentrum gelegenen und von Touristen wenig frequentierten Museum der schönen Künste. Dieses vermutlich letzte Werk Boschs ist eine unglaubliche Komposition, ein Gemälde von dichtgedrängten Halbfiguren ohne erkennbaren Bezug zu einem Raum oder der Landschaft auf dem Weg nach Golgatha. In der Mitte Christus unter der Last des Kreuzes gebeugt, aber mit geschlossenen Augen, als träume er nur diesen Albtraum. Unglaublich sind auch die Farbzusammenstellungen: delikates Gelb, weiches Hellblau und Schwarz haben z. B. dem Gesicht der Veronika eine beängstigende Blässe gegeben und es in eine wächserne Maske verwandelt. (Ähnlich leuchtende Farbzusammenstellungen Boschs vor einem schwarzen Hintergrund kenne ich nur noch von dem in der Münchner Pinakothek hängenden Fragment eines Jüngsten Gerichts.)
In Brügge sei natürlich auf die Madonna von Michelangelo in der Liebfrauenkirche, auf „Die mystische Vermählung der hl. Katharina“ von Hans Memling im Memling-Museum und auf die „Madonna des Kanonikus van der Paele“ von Jan van Eyck im Museum Groeninge hingewiesen.
Im weiteren Verlauf der Reise wurde nach einem Abstecher nach Ypern in Lille Station gemacht. Ypern war schon im Hochmittelalter berühmt für seine Tuchhalle, zeitweise das größte Gebäude Europas. Im ersten Weltkrieg wurde die Stadt in drei Schlachten fast vollständig zerstört, aber Tuchhalle und hochgotische Kathedrale wurden nach dem Krieg ohne Vereinfachungen vollständig wiederaufgebaut. Heute beherbergt die Tuchhalle das Museum „In Flandern Fields“, eine interaktive Ausstellung mit erschütternden Erlebnisberichten und Dokumenten über die Schlachtfelder bei Ypern.
Lille hat den Jahrzehnte dauernden wirtschaftlichen Niedergang gestoppt, heruntergekommene Viertel saniert und ist heute eine sehr lebhafte Stadt mit dem, was die Anzahl der ausgestellten Kunstwerke betrifft, zweitgrößten Museum Frankreichs nach dem Louvre. Zu den Hauptwerken gehören unter anderem zwei späte Gemälde von Goya: „Zwei alte Frauen“ und „Die Briefleserin“.
Besonders interessant ist aber zur Zeit eine Sonderausstellung mit über zwanzig Bildern der Berliner Künstlergruppe interDuck. Die Maler der Gruppe wollen den Nachweis führen, dass Entenhausen nicht kulturlos ist, und verwenden als Vorlage berühmte Gemälde großer Meister, auf denen sie die Hauptfiguren durch Donald Duck und Anverwandte ersetzen. So sieht man in Lille unter anderem Donald als Mann mit dem Goldhelm, als Watteaus Gilles, Manets Pfeifer und Daisy als Mona Lisa, als Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring, als Bouchers Nackte auf dem Sofa und als Goyas Briefleserin sowie die gesamte Sippschaft im Konzert im Ei und im Schlaraffenland. Die Bilder hängen glücklicherweise nicht in einem als Sonderausstellung deklarierten Raum, sondern verstreut und wie zufällig plaziert zwischen den alten Meistern des Museums. Ein großes Vergnügen!
Einige Kilometer südlich von Lille liegt Lens, eine Kleinstadt, mit der bis vor kurzem niemand Kunstwerke irgendeiner Art in Verbindung gebracht hätte. Diese Stadt, die einhundert Jahre vom Steinkohlebergbau gelebt hat und dessen Abraumhalden noch heute die Landschaft bestimmen, gewann einen Wettbewerb um eine Dependance des Louvre und besitzt heute ein sehenswertes und sehr schönes Kunstmuseum besonderer Art. Auf dem aufgelassenen Gelände einer Zeche stehen fünf miteinander verbundene Gebäude, darunter eine 130 Meter lange Halle für die Dauerausstellung und ein 90 Meter langes weiteres Gebäude für Sonderausstellungen. Die große Halle besitzt keine Fenster und keine Trennwände. Die über 200 Objekte stehen frei oder auf Podesten, Gemälde hängen an kleinen Stellwänden. Angelegt ist die Ausstellung als ein offenes Labyrinth, als ein Spaziergang durch die Zeit, der im dritten Jahrtausend v. Chr. beginnt und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts endet. Eine Besonderheit ist außerdem, dass nach jedem Jahr zehn Prozent des Bestandes ausgewechselt werden – so hat man Grund, einen Besuch in Lens in größeren Abständen zu wiederholen, um den Veränderungen nachzuspüren. (Kritiker haben diesem Konzept Beliebigkeit vorgeworfen. Für mich nicht verständlich, weil in jeder Sammlung durch ihre Entstehungsgeschichte mit der Verfügbarkeit des Kunstmarktes, dem Wechsel des Geschmacks und der Vorlieben der Käufer eine gewisse Beliebigkeit oder besser Zufälligkeit unvermeidlich ist.)
Im ersten Jahr nach der Eröffnung im Dezember 2012 begann der Spaziergang mit der schwarzen Statue des Prinzen Gudea aus Lagasch, und an der Rückwand der Halle hing als krönender Abschluss das berühmte Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ von Delacroix aus dem Jahr 1830. Augenblicklich bildet das Gemälde „Roger befreit Angelika“von Ingres den Beschluss. Es illustriert eine Stelle im Versepos „Der rasende Roland“ von Ariost, für die das mythologische Thema der gefesselten Andromeda die Quelle war. Das Bild ist leider viel schwächer als das von Delacroix – sowohl, was das Thema angeht, als auch in der Ausführung: Angelika schmachtet, der Drache ist klein und wirkt ängstlich, fast hilflos. Kein Gegner für den heldenhaften Roger auf seinem Hippogreif. Da sind die Drachen von Daenerys Targaryen aus „Game of Thrones“ doch ein ganz anderes Kaliber.
Im Umfeld von Lille gibt es weitere lohnenswerte Besuchsziele: nordwestlich im Künstlerort Sint-Idesbald am Meer vor Veurne das Paul Delvaux Museum, nördlich in Roubaix das zu einem Museum umgebaute Jugendstilschwimmbad, östlich in Tournai die Kathedrale mit ihrer Fünfturmgruppe und südöstlich etwas weiter entfernt das Matisse-Museum in Le Cateau-Cambrésis.
Die Studienreise endete mit einem Abstecher nach Mons - derzeit Kulturhauptstadt Europas - und einem Besuch der der hl. Waltraut geweihten spätgotischen Stiftskirche, die trotz langer Bauzeit in imponierender Einheitlichkeit errichtet wurde und für mich von den zwölf gotischen Kirchen, die im Verlauf der Reise besichtigt wurden, die schönste war. Schade nur, dass der Turm, der eine Höhe von 187 Metern erreichen sollte, nie gebaut wurde.
(Im Juni 2015)
Da ich zu Beginn meines Berufslebens längere Zeit in einer amerikanischen Werbeagentur gearbeitet habe, machten mich vor fünf oder sechs Jahren die ersten Meldungen über Nominierungen und Auszeichnungen der Fernsehserie „Mad Men“ ziemlich neugierig. Die Ausstrahlung der Staffeln in Deutschland bei ZDF Neo verpasste ich jedoch zunächst – wir hatten noch keinen HD-Antennenzugang. Erst ab der vierten Staffel habe ich die Serie (mit Lücken) verfolgt. Kürzlich erzählte ein Freund bei einem Abendessen, er habe die Staffeln eins bis sechs auf DVD und bot an, sie mir auszuleihen. Ich habe dankbar zugegriffen und danach in einem Zeitraum von fünf Wochen 78 Folgen gesehen.
Kann man solche Zeitvergeudung rechtfertigen? Muss ich sie rechtfertigen? Worum geht es überhaupt? Es geht um ein halbes Dutzend Männer und Frauen, die während der 60er Jahre in einer kleinen Werbeagentur auf der Madison Avenue in New York arbeiten (daher der doppeldeutige Titel der Serie) und vergeblich versuchen, ihr chaotisches Privatleben in den Griff zu kriegen. Hauptfigur ist Don Draper, der im Koreakrieg Fahnenflucht beging und sich eine neue Identität zulegte. In Rückblenden erfährt man darüber hinaus von seiner schrecklichen Kindheit, wobei mich diese Szenen immer an Steinbecks schon lange vergessene Romane „Jenseits von Eden“ und „Die Früchte des Zorns“ erinnerten. Draper ist der kreative Kopf der Agentur, der die originellsten Werbekonzepte aus dem Ärmel schüttelt und damit in Krisen den Erhalt der Werbeetats sichert. Er ist verheiratet und hat eine Tochter, betrügt aber seine Frau nach Strich und Faden. Auch nach Scheidung und neuer Heirat nimmt er, was er kriegen kann, sodass ihn am Ende auch seine zweite Frau verlässt. Neben ihm und zwei weiteren männlichen Arbeitskollegen sind zwei Frauen Hauptfiguren der Geschichte: Peggy Olson und Joan Harris. Die aus strengem katholischen Milieu stammende Peggy beginnt als Sekretärin und wird zu einer erfolgreichen Texterin, am Ende sogar zur Vorgesetzten ihres früheren Mentors Draper. Sie verheimlicht eine ungewollte Schwangerschaft, gibt das Baby nach der Geburt zur Adoption frei und hat bei ihrer Suche nach einem verlässlichen Partner lange kein Glück. Joan Harris ist die Büroleiterin, die den Laden zusammenhält. Sie lässt sich auf ein Verhältnis mit einem der Agenturinhaber ein, bringt der Agentur für den Gewinn eines Etats ein persönliches Opfer und lässt sich dafür mit einer Beteiligung entschädigen. Später heiratet sie eine Zufallsbekanntschaft, wird schwanger und wirft ihren Mann wegen homosexueller Neigungen aus der Wohnung.
Im Lauf der Zeit erlebt die Agentur Höhen und Tiefen. Nach dem Verlust eines großen Etats wird sie von einer Londoner Werbeagentur aufgekauft, später neu gegründet und nach einer Fusion ein zweites Mal verkauft. Am Ende gehen die Hauptpersonen getrennter Wege.
Die gesamte Handlung ist sehr geschickt in die 60er Jahre eingebunden, schwerwiegende Fehler sind mir nicht aufgefallen, allenfalls ist die extreme Farbigkeit der Kleider und Anzüge zu beanstanden. Im ersten Jahr verfolgen die Mitarbeiter der Werbeagentur am Fernseher die Wahl von John F. Kennedy zum Präsidenten, reden über den Twist und den Film „Das Apartment“, und Don Draper liest abends im Bett den Roman „Exodus“ von Leon Uris. Im zweiten Jahr kauft einer der Inhaber der Agentur ein Bild von Mark Rothko als Geldanlage, die Mitarbeiter sprechen über die Kubakrise und ein Konzert von Bob Dylan in der Carnegie Hall. Im dritten Jahr wird Kennedy ermordet, und Don Drapers Ehefrau Betty liest den Roman „Die Clique“ von Mary McCarthy. Im vierten Jahr wird über den Boxkampf zwischen Sonny Liston und Cassius Clay sowie über den Auftritt der Beatles in den USA gesprochen. Zum ersten Mal tauchen Japaner als potentielle Kunden auf: Die Agentur bewirbt sich um den Motorradetat von Honda. Um die japanische Mentalität zu verstehen, liest Draper das Buch „Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture“ von der Anthropologin Ruth Benedict aus dem Jahr 1946. Die anschließende Präsentation endet jedoch in einem Desaster, weil einer der Agenturinhaber auf den zweiten Weltkrieg zu sprechen kommt und heftige Beleidigungen ausstößt. Im fünften Jahr sind die Rolling Stones Geprächsstoff, im sechsten die Ermordung von Martin Luther King, das Musical „Hair“ sowie die Filme „Bonnie und Clyde“, „Planet der Affen“ und „Rosemarys Baby“, im siebten die Landung auf dem Mond und Kubricks Film „2001: A Space Odyssey“.
Was fällt einem noch auf? Die Männer sind Kettenraucher und Alkoholiker, beständig nehmen sie einen Drink. Rassismus (als Beispiel die Aussage eines Kunden: „Wir machen keine Werbung in Zeitschriften, die Neger lesen. Wir brauchen keine Neger, die unsere Waschmaschinen kaufen“) und Antisemitismus (gegen New Yorker Juden) werden in den ersten Jahren offen gezeigt, homosexuelle Neigungen werden in den ersten Jahren versteckt, später offen eingestreut. (In einer Bar wird Peggy von einer Lesbe angemacht. Als sie antwortet, sie habe einen Freund, erwidert die, ihre Vagina gehöre doch nicht ihm. Worauf Peggy entgegnet: „Well, he rented it – kind of.) Die präsentierten Werbekampagnen und die Diskussionen mit den Kunden sind ziemlich dämlich, die Kampagne für Heinz Bohnen in Dosen mit dem Motto „Manche Dinge ändern sich nie“ schießt dabei den Vogel ab. Bei der Formulierung der Produktversprechen ist Draper genauso skrupellos wie in seinem Umgang mit den Frauen. Jede Lüge ist erlaubt, wenn es darum geht, Frauen flachzulegen oder den Kundenetat zu halten.
Inzwischen sind die letzten sieben Folgen der siebten Staffel in den USA gelaufen. Da ich sie noch nicht gesehen habe, möchte ich sie nicht kommentieren. Inhaltsangaben findet man leicht im Internet.
(Im Mai 2015)

Im vergangenen Herbst hielt der Bonner Kunsthistoriker Satzinger in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Düsseldorf einen Vortrag über das Nachwirken von Michelangelo und begann mit dem die Zuhörer überraschenden Satz, er wolle sich dem Thema mit vier Begriffen nähern: stehen, sitzen, liegen und schweben. Zur Illustration zeigte er eine moderne Fassung der bekannten Szene von der Decke der Sixtinischen Kapelle, in der Gott schwebend Adam das Leben gibt. In der amerikanischen Fassung war Gott durch Walt Disney ersetzt worden und die Engel durch allerlei bekannte Comic-Figuren. Das Publikum lachte – teilweise mit Verzögerung, teilweise betreten. Danach hielt er einen sehr anregenden Vortrag, zeigte zu den vier genannten Kategorien jeweils Schlüsselwerke von Michelangelo (den stehenden David, einen oder mehrere sitzende Jünglinge von der Decke der Sixtinischen Kapelle, die liegende Aurora und Gottvater in der Woge seines Mantels fliegend) und danach vielfältige Beispiele für die Rezeption dieser Figuren bis in unsere Zeit hinein.
Zu diesem Thema läuft bis 25. Mai 2015 in der Bundeskunsthalle Bonn eine Ausstellung unter dem Titel „Der Göttliche – Hommage an Michelangelo“. In der Ausstellung geht es primär nicht um die Präsentation von Meisterwerken Michelangelos (sie sind nur mit Abgüssen, Kopien und Fotografien vertreten), sondern um deren Rezeption und Verarbeitung in Form von Skulpturen, Plastiken, Gemälden, Zeichnungen und Drucken „nach Michelangelo“.
Leider beginnt die Ausstellung nicht wie der Vortrag mit dem provokanten Walt Disney als Gottvater, sondern sehr konventionell mit Michelangelos Porträt nach seiner Totenmaske und einem Vergleich mit einem Kopf Redons. Im ersten Raum geht es um „stehen“, die Besucher werden mit den beiden Gefangenen konfrontiert, die Michelangelo für das Grabmal des Papstes Julius II. schuf, die aber dem Papst nicht zusagten, deshalb ausgesondert wurden, in Privatsammlungen verschwanden und erst 280 Jahre später während der französischen Revolution fürs Publikum zugänglich wurden. Dadurch setzte auch die Rezeption erst vergleichsweite spät ein, zu der in der Ausstellung u. a. eine moderne Aneignung mit einfachen Mitteln von Yves Klein (er besprühte eine Miniaturausgabe eines Sklaven mit seiner blauen Farbe) und eine teilweise bemalte, Apoll betitelte Figur von Lüpertz gezeigt werden. Ob Lüpertz mit diesem Vergleich ein Gefallen getan wurde, ob seine grobschlächtige Figur als kritische Distanzierung aufgefasst werden kann, mag jeder Besucher für sich entscheiden.
Den Übergang zum zweiten Raum markiert ein großes Foto des stehenden David von Candida Höfer. Dabei ist es der Fotografin gelungen, den Raum, in dem der David heute besichtigt werden kann, vom Fußboden bis zur Kuppel abzulichten, wodurch die Statue an Wucht verliert und auf Menschenmaß reduziert zu sein scheint.
Der zweite Raum ist dem Jüngsten Gericht von der Altarrückwand der Sixtinischen Kapelle gewidmet. Das riesige Original hat eine Größe von siebzehn mal dreizehn Metern, und in dem in einen Wirbel von fast vierhundert Gestalten aufgelösten Fresko überwiegen stehende Figuren, dazwischen sieht man aber auch sitzende, schwebende und stürzende. Übrigens sind fast ausschließlich Männer abgebildet, kaum Frauen. Mehr als zehn habe ich bislang nicht entdecken können. Wo sind nur all die toten Frauen geblieben? Vielleicht dürfen sie am Jüngsten Tag erst dann ihren Gräbern entsteigen, wenn die Männer sortiert und entweder der Verdammnis überantwortet oder ins Paradies geleitet worden sind. Wie dem auch sei, mit diesem Fresko hat Michelangelo ein fast unerschöpfliches Musterbuch menschlicher männlicher Körper in den unterschiedlichsten Haltungen geschaffen, ein Quell, aus dem viele Künstler nach ihm geschöpft haben. Die vermutlich bekannteste Aneignung stammt von Rodin, der für seinen „Denker“ einen zur Verdammnis Verurteilten zum Vorbild nahm. In Bonn ist vom Jüngsten Gericht eine stark verkleinerte Kopie aus der Zeit um 1570 ausgestellt, von der Experten sagen, sie habe die Farbigkeit des Originals gut getroffen.
Im anschließenden Raum wird als Beispiel des Sitzens einer von insgesamt zwanzig Jünglingen des Deckenfreskos gezeigt, das dreißig Jahre vor dem Jüngsten Gericht gemalt wurde. Zur Entstehung des Deckenfreskos gibt es das Gerücht, Raffael habe dem Papst vorgeschlagen, Michelangelo mit der Ausmalung zu beauftragen. Nicht aus Freundschaft, sondern aus Neid und weil er hoffte, Michelangelo werde an der Aufgabe scheitern. Er sollte sich irren. Obwohl Michelangelo sich immer als Bildhauer sah, war er auch ein großartiger Maler und fabelhafter Kolorist. Was wir erst seit der Reinigung der 90er Jahre wieder entdeckt haben. Viel mehr ist in Bonn von der Decke leider nicht sehen – von der bekannten und schon erwähnten Szene der Erschaffung Adams auch nur der noch matt auf der Erde liegende Adam – der heranfliegende Gottvater nebst neugieriger Eva wurde gestrichen. Warum?
In einem weiteren Ausstellungsraum wird die Thematik der Körperpositionen unterbrochen. Der Besucher sieht sich unvermittelt großen Fotografien gegenüber, die seinesgleichen zeigen: Besucher vor einem Kunstwerk. Das Kunstwerk ist allerdings nicht zu sehen, weil die Kamera seine Position eingenommen hat oder vielleicht versteckt daneben aufgestellt wurde. Beim zweiten Hinsehen fällt auf, dass die Besuchergruppen alle nach oben blicken und dass sie auf einem Boden stehen, den wir von Candida Höfers David-Foto schon kennen: Wir befinden uns neben dem Sockel der David-Statue. Wenn wir jetzt noch einmal genau hinschauen, fällt uns vielleicht auf, dass auf einem Bild zwei der fotografierten Besucher nicht nach oben blicken, sondern in die Kamera und damit uns ansehen. Und schließlich gilt es, noch eine Raffinesse zu entdecken. Einer der Besucher hat seine Sonnenbrille in den Spalt seines Hemdes gesteckt, wodurch sich etwas in den Gläsern spiegelt: eine weiße Figur auf einem Sockel.
Bei der Fortsetzung des Rundgangs gelangen wir zu den liegenden Skulpturen mit der Nacht und der Morgenröte (der Aurora) vom Medici-Grabmal in Florenz. Vor allem diese Figuren haben eine anhaltende Nachwirkung erzielt, sie sind kopiert und abgewandelt worden, unter anderem von Rodin, der sich nach seinen eigenen Aussagen umfangreich mit ihnen auseinandergesetzt hat. An den Körpern der beiden Frauengestalten fällt auf, dass sie sehr muskulös wirken und ihnen weibliche Weichheit fehlt. Dass Michelangelo seine sexuelle Befriedigung bei Männern suchte, ist heute allgemein bekannt, nicht so bekannt ist, dass er männliche Modelle auch für die wenigen nackten Frauen, die er malte oder als Bildhauer schuf, benutzte. Trotz dieser Präferenz fürs eigene Geschlecht hat er einige außergewöhnlich schöne Frauen geschaffen: die Madonna von Brügge, die Pietà della Febbre und vor allem die Delphische Sibylle, die jüngste und reizvollste der fünf Sibyllen an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Ihr Kopf ist wunderbar und besitzt zusammen mit dem Kopftuch eine starke plastische Wirkung. Augen, Augenbrauen, Wangen, Nase, leicht geöffneter (fragender) Mund und Kinn bilden ein vollkommenes Gesicht. Dazu kommen Haltung und Bewegung der Figur sowie eine perfekte Farbgebung. Mit der Delphischen Sibylle hat Michelangelo ein Jahrhundertbild geschaffen. In Bonn ist sie nicht zu sehen. Allerdings wüsste ich auch keinen späteren Künstler, der versucht hätte, diese Figur nachzuahmen oder modern zu interpretieren.
(April 2015)

Als ich zehn Jahre alt war, lieh mir ein Klassenkamerad (so hieß das damals) über die Ferien ein Buch von Gustav Schwab mit dem Titel: Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. In dem Buch habe ich die Taten des Herakles gelesen, die Geschichte von Dädalus und Ikarus, die Fahrt der Argonauten und die Tragödie des Ödipus. Dann waren die Ferien herum, und ich musste das Buch zurückgeben. Soweit ich mich erinnern kann, fand ich die Abenteuer der Argonauten besonders spannend und habe viele Einzelheiten behalten, während ich dagegen die Taten des Herakles weitgehend vergessen habe. Vermutlich habe ich die Geschichte von Jason und Medea aber nur deshalb besser behalten, weil ich einige Zeit später auf dem Speicher unseres Hauses zwischen alten Büchern meines Vaters mehrere Exemplare von Schaffsteins Blauen Bändchen aus den zwanziger Jahren entdeckte, darunter eine illustrierte Ausgabe der Argonautenfahrt. Auf jeden Fall habe ich mich auch später immer wieder mit dem Stoff der Argonauten und dem Schicksal Medeas beschäftigt, was schließlich dazu führte, dass das sprechende Schiff Argo als Vorlage für die Segeljacht Amiramis in meinem Roman „2101“ diente und dass eine der Hauptfiguren den Namen Medea erhielt.
Ich will mich jetzt nicht in einer Beschreibung oder gar einem Psychogramm der ambivalenten Persönlichkeit Medeas verlieren. Dazu ist schon vieles gesagt worden. In seinem Buch „Mythos Medea“ zum Beispiel zählt Ludger Lütkehaus fast 40 Bearbeitungen des Stoffes auf von Euripides über Ovid, Seneca, Boccaccio, Chaucer, Corneille, Lessing, Grillparzer, Nietsche, Langgässer, Anouilh bis Christa Wolf und Heiner Müller.
Hinweisen möchte ich dagegen darauf, dass Medea ein sehr alter Mythos ist, wahrscheinlich älter als die Ilias von Homer und dass erst Euripides Medea den Kindesmord angehängt hat. Im Lauf der frühen Jahrhunderte wurde die ursprüngliche Überlieferung erweitert und verändert, Teile unterschiedlicher Herkunft wurden integriert, abweichende Versionen entstanden. Schon in den ältesten Fassungen war Medea eine Königstochter von göttlicher Abstammung, die Jason half, das Goldene Vlies zu rauben, und ihm freiwillig nach Griechenland folgte. In diesen Fassungen endete die Geschichte noch ohne Tragik, ohne Verbrechen und ohne einen Lebensabschnitt Medeas in Korinth. Im Lauf der Zeit veränderten sich zunächst die Rollen von Jason und Medea beim Raub des Goldenen Vlieses – der Anteil der zauberkundigen Medea wuchs, die Tapferkeit Jasons genügte nicht mehr, um die ihm gestellten Aufgaben aus eigener Kraft zu meistern. Möglicherweise wurde dadurch ein Keim zur Eifersucht gelegt, aus der sich später Jasons Undankbarkeit entwickelte. (Das ist eine Spekulation, Textbelege gibt es dafür nicht.) Die erste Wendung zur Ehetragödie entstand, als in einer Version des siebten Jahrhunderts v. Chr., die in Korinth spielte, beide Kinder Medeas und Jasons starben, weil Medea versuchte, sie durch einen Zauber unsterblich zu machen. Jason weigerte sich, Medea den Tod der Kinder zu verzeihen, und trennte sich von ihr. Der Tod der Kinder wurde später Bestandteil weiterer Fassungen, die immer düsterer ausfielen und Medeas Schuld vergrößerten (Brudermord auf der Flucht aus Kolchis, Königsmord in Korinth). Auf all diese Wendungen griff Euripides zurück und entwarf den irrationalen Charakter, den wir heute mit Medea verbinden. Wobei es auch Vermutungen gibt, dass Euripides Medea als Auftragsstück schrieb – im Auftrag Korinths, um Athen herabzusetzen. Nach der Überlieferung des fünften Jahrhunderts tötete nämlich Medea den König von Korinth und flüchtete nach Athen, musste aber ihre Kinder in Korinth zurücklassen, die von Kreons Verwandten ermordet wurden.
Im Theater habe ich zwei bemerkenswerte Aufführungen erlebt. 2008 inszenierte Karin Beier den Stoff in Köln und verwendete dafür die selten gespielte Trilogie „Das Goldene Vlies“ von Grillparzer. 2012 brachte Michael Thalheimer die Medea von Euripides in Frankfurt auf die Bühne. Karin Beierreduzierte das umfangreiche Stück Grillparzers auf vier Schauspieler, die – abgesehen von Maria Schrader als Medea – Doppelrollen übernehmen mussten. Inhaltlich kürzte sie die Vorgeschichte mit dem Raub des Goldenen Vlieses in Kolchis und konzentrierte sich auf die Ereignisse in Korinth. Dort erscheint Medea als Barbarin aus der Fremde, die keinen Anspruch auf menschliche Behandlung hat. Sie muss man erst erziehen, ihr die Grundregeln der Zivilisation beibringen. Hier ist Beier eine unvergessliche Szene gelungen. Medea wird ein Cello mit der Aufforderung in die Hand gedrückt, sie solle lernen, es zu spielen. Da sie sich nach einigen Versuchen weigert, bleibt sie ausgegrenzt. Zehn Jahre lebt sie mit Jason in Korinth und bringt zwei Kinder zur Welt, bevor Kreon Jason seine Tochter Kreusa, die inzwischen herangewachsen und heiratsfähig ist, zur Frau anbietet, aber auch verlangt, dass Medea mit ihren Kindern Korinth verlässt. Jason nimmt das Angebot opportunistisch an und scheint froh zu sein, dass er Medea loswird, die ihn ständig daran erinnert, dass er gar nicht der berühmte Held ist, sondern seinen Ruhm ihr zu verdanken hat. Auch an seinen Kindern liegt ihm, so lange sie leben, nichts, weil sie nur als Bastarde gelten und er mit der jungen Kreusa neue legitime Söhne zeugen will. Leider liegt die Aufführung schon sieben Jahre zurück, und da ich mir damals keine Notizen gemacht habe, weiß ich nicht mehr, wie Beier das Stück enden ließ. Auf jeden Fall ging von dem Spiel eine große, packende Intensität aus, die die Begeisterung der Presse verständlich machte. Die Inszenierung verwandelte Medea in eine moderne Ehegeschichte eines Paares aus unterschiedlichen Kulturen mit einem fast zwangsläufigen Verlauf und einer Katastrophe am Ende. (Dass man das Stück als Vorläufer moderner Ehetragödien ansehen kann, stellte übrigens Benno von Wiese bereits 1948 in seiner Darstellung der deutschen Tragödie von Lessing bis Hebbel fest.)
Die Frankfurter Inszenierung der Medea von Euripides mit Constance Becker in der Hauptrolle habe ich erst vor wenigen Tagen in Düsseldorf gesehen. Nach einem Auftritt der Amme und des Chores zur Erläuterung der Vorgeschichte erscheint Kreon und verjagt Medea mitsamt ihren Kindern aus Korinth. Sie erbittet einen Tag Aufschub. Dann nimmt die Geschichte ihren bekannten Lauf. Beeindruckend ist das Spiel von Constance Becker, beeindruckend ist die karge Inszenierung im Geist Peter Brooks, der übrigens vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden ist. Die Bühne ist vollkommen leer, im Hintergrund ragt eine schwarze Mauer ohne Fenster oder Türen bis in den Himmel. In halber Höhe ist die Mauer durch eine Linie, die einen Mauervorsprung andeutet, horizontal geteilt. Auf diesem Mauervorsprung liegt, kniet, sitzt, steht, spricht, verhandelt, droht, schmeichelt, bittet, fleht, flüstert und schreit Medea während des gesamten Stückes. Erstaunlich, überwältigend und im Zentrum die bekannten Sätze: „Vor welcher Tat ich steh, begreif ich wohl. Doch stärker als Vernunft ist Leidenschaft. Aus ihr entstehen der Menschen schwerste Leiden.“
(April 2015)

Habe einen kleinen Gedächtnistest gemacht und auf einem leeren Blatt Namen der Filme aufgeschrieben, die ich meiner Erinnerung nach während der Schulzeit im Kino gesehen habe und an deren Handlung ich mich noch weitgehend erinnern kann. Nach zehn Minuten hatte ich rund 40 Filmtitel aufgeschrieben, darunter waren 5 Filme von Hitchcock, 4 von Walt Disney, nur 6 deutsche und nur 2 französische Filme. Außerdem hatte ich eine Reihe von Szenen aus weiteren Filmen vor Augen, konnte mit ihnen aber keinen Filmtitel mehr verknüpfen. Dann habe ich aus der Liste die Filme gestrichen, die ich später (überwiegend im Fernsehen) ein zweites oder drittes Mal gesehen habe (darunter alle Hitchcock-Filme – Vertigo z. B. habe ich mindestens dreimal gesehen). Übrig blieben zwanzig Filme, und das waren jetzt die ersten zehn: Ladykillers (mit Alec Guinness aus dem Jahr 1955), Die zwölf Geschworenen (mit Henry Fonda 1957), Die Brücke am Kwai (1957), Hamlet (mit L. Olivier 1948), Krieg und Frieden (1956), Der Hauptmann von Köpenick (mit Heinz Rühmann 1956), Das doppelte Lottchen (1950), Pinocchio (von Walt Disney, in Deutschland 1951 gezeigt), Cinderella (von Walt Disney, in Deutschland 1952 in den Kinos) und Giganten (mit James Dean, Rock Hudson und Elizabeth Taylor 1956).
Cinderella hieß damals noch Aschenputtel, ich erinnere mich vor allem an die Szene, in der die gute Fee einen Kürbis in die Kutsche verwandelte, und eine Melodie habe ich auch noch im Ohr, kann sie aber nicht nachsingen.
Jetzt läuft wieder eine Cinderella-Verfilmung in den Kinos, was TIME dazu veranlasste, einen längeren Artikel über die vielen Verfilmungen des Märchens zu schreiben. Bereits Georges Méliès, an den erst vor drei Jahren in „Hugo Cabret“ erinnert wurde, nahm sich 1899 den Stoff vor, 1915 spielte Mary Pickford die Rolle, und der Zeichentrickfilm von 1950 rettete Walt Disney vor dem Konkurs. Dieser Zeichentrickfilm widmete der eigentlichen Märchenhandlung nur die Hälfte des Films, die andere Hälfte blieb vier sprechenden Mäusen und ihrem Kampf mit einem widerwärtigen Kater Lucifer vorbehalten. Bezeichnenderweise war der Prinz kein Teil der Handlung und erschien erst in der letzten Szene. 1977 spielte Julie Andrews die Rolle in einem Musical, und in einer Neufassung des Musicals war 1997 Whitney Huston als gute Fee zu sehen. Die vorletzte Bearbeitung unter dem Titel „Into the Woods“ vermischte 2014 Cinderella mit Rotkäppchen und anderen Märchen, war auch ein Musical und lief noch vor wenigen Wochen in unseren Kinos.
In der Disney-Neuverfilmung führt Kenneth Branagh Regie, der mit seinen Interpretationen von Shakespeare-Stücken berühmt geworden ist; er hat dem Stoff neue Wendungen gegeben, die Vorgeschichte hinzugefügt, dem Prinzen eine tragende Rolle zugeteilt und die Figuren mit guten Schauspielern besetzt. Dass Cate Blanchett eine bösartige Stiefmutter Lady Tremaine abgeben würde, konnte sich jeder denken, der sie kennt und beispielsweise als skrupellose CIA-Agentin Marissa Wiegler in „Wer ist Hanna?“ gesehen hat. Als hinterhältige Stiefmutter übertreibt sie fast ihre Rolle und stolpert manchmal über die Grenze zur Parodie. Dass Richard Madden einen veritablen Prinzen mit Charme und Herz spielen würde, konnte sich auch jeder denken, der ihn als Robb Stark in „Game of Thrones“ erlebt hat. Und in den Nebenrollen kennt man den intriganten Herzog (Stellan Skarsgard) aus „Verblendung“ sowie den Captain (Nonso Anozie) auch aus „Game of Thrones“, wo er Daenerys Targaryen, die Heldin aller Herzen, hintergehen will und von ihr dafür gebührend bestraft wird. So bleibt als große Überraschung Cinderella. Als ich sie zum ersten Mal auf dem Filmplakat in dem wunderschönen blauen Ballkleid sah, kam sie mir irgendwie bekannt vor, und ich brauchte eine Weile, bis ich sie einordnen konnte: Sie heißt Lily James und hat in „Downton Abbey“ eine Nebenrolle als Lady Rose, die immer lächelt, sich durchs Leben lächelt, wobei man nicht weiß, lächelt sie bloß dümmlich oder schüchtern oder clever (nach dem Motto: Sei schlau und stell dich dumm). In der Serie flirtet sie erst mit einem schwarzen Jazzmusiker (shocking - wir sind in den 20er Jahren!) und heiratet später einen jüdischen Lord. Als Ella ist sie bezaubernd und profitiert davon, dass Branagh ihre Rolle ziemlich modern angelegt hat: Sie erduldet ihr Geschick nicht mehr unterwürfig, sondern leistet auch subtilen Widerstand und bekommt am Ende, was sie sich wünscht.
(März 2015)

Sie sei derzeit ubiquitous (allgegenwärtig) schrieb kürzlich TIME über die amerikanische Film- und Theaterschauspielerin Jessica Chastain. Tatsächlich hat die heute 38jährige seit 2011 in einer Reihe bemerkenswerter Filme mitgespielt, gerade ist in Deutschland „A most Violent Year“ angelaufen, und für das laufende Jahr und für 2016 sind 6 weitere Filme angekündigt.
Der Durchbruch gelang der rothaarigen Chastain vergleichsweise spät im Jahr 2011 mit zwei Filmen. In dem Thriller „Eine offene Rechnung“, in dem ich sie zum ersten Mal gesehen habe, spielt sie eine Mossad-Agentin, die in Ost-Berlin (noch in Zeiten der DDR) einen NS-Kriegsverbrecher aufspüren soll. In „The Help“ hatte sie eine Nebenrolle, für die sie eine Golden-Globe- und Oscar-Nominierung erhielt. 2012 wurde ein großes Jahr für sie: In „The Tree of Life“, dem lang erwarteten Film von Terrence Malik, der in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, hatte sie die weibliche Hauptrolle. Die sanftmütige Ehefrau kontrastierte sie wenig später in „Zero Dark Thirty“ mit der Rolle der CIA-Agentin Maya, die rastlos den Spuren Osama bin Ladens nachgeht und ihn aufspürt. Sie ist der einsame Wolf, der sich nicht von seiner Überzeugung abbringen lässt, dass Osama bin Laden sich nicht in irgendeiner Höhle in den Bergen Afghanistans versteckt hält, sondern irgendwo unter Menschen lebt. Als Maya zeigte Chastain erneut, welch vielseitige Schauspielerin sie ist. Abgesehen von Meryl Streep gibt es wohl keinen Hollywood-Star, der so überzeugend in die interschiedlichsten Rollen schlüpfen kann. Für „Zero Dark Thirty“ erhielt sie den Golden-Globe und eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Da der Film in den USA wegen der Folterszenen heftige Kontroversen auslöste (den Linken fehlte die Stellungnahme gegen die Folterungen, den Rechten passte das ganze Thema nicht), wurde Chastain bei der Oscar-Wahl übergangen. Sie hätte ihn verdient. (Statt ihrer wurde Jennifer Lawrence ausgezeichnet. Für eine Komödie. Offensichtlich ein Kompromiss. J. L. kann zwar auch „alles“ spielen, aber sie ist erst 24 und zu jung für eine der Maya vergleichbare Rolle.)
2013 drehte sie „Das Verschwinden der Eleanor Rigby“, ein interessantes Experiment, in dem eine Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt wird (ähnlich „Gone Girl“). 2014 kam sie mit „Fräulein Julie“ und „Interstellar“ in die Kinos – und jetzt also „A most Violent Year“, ein Film über New York im Jahr 1981. Mit 1,2 Millionen Straftaten erreichte die Verbrechensrate in der Stadt ihren Höhepunkt, Justiz und Polizei waren bestechlich, gaben sich hilflos oder mischten kräftig mit im Sumpf aus Korruption, Entführungen, Morden, Raubüberfällen und anderen Verbrechen; 1981 war ein Jahr der äußersten Gewalt. Vor diesem Hintergrund wird die Geschichte eines Einwanderers erzählt, der versucht, sein Geschäft zu retten, ohne sich an das organisierte Verbrechen zu verkaufen. Chastain spielt die Ehefrau, loyal, gierig, skrupellos und ziemlich sexy. Der Film sieht aus wie ein Gangsterfilm, ist aber eher eine Charakterstudie über das Aufeinanderprallen zweier völlig unterschiedlicher Lebensvorstellungen.
Chastains Vielseitigkeit zeigt sich auch in den angekündigten Filmen: „Crimson Peak“ ist ein Horrorfilm, „The Martian” ist SF von Ridley Scott (Alien, Blade Runner usw.), „The Zookeeper’s Wife" ein Drama aus dem zweiten Weltkrieg, und in “Blonde” verkörpert sie Marilyn Monroe.
(März 2015)
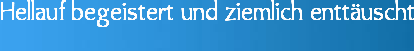
Die Geschichte des Sammlers Osthaus aus Hagen, die Entstehung seiner Folkwang-Sammlung und des Museumsbaus mit einer Innenausstattung im Jugendstil, der Verkauf der Sammlung samt Namensrechten nach Essen und ihr weiteres Schicksal im Dritten Reich kann man an verschiedenen Stellen nachlesen. Gut zusammengefasst z. B. in dem von Dietmar Schmidt herausgegebenen Museumsführer „Moderne Kunst in NRW“, 2003 bei Dumont.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in Hagen mit bescheidenen Mitteln eine neue Sammlung zur Kunst des 20. Jahrhunderts, die sich den Ideen von Osthaus verpflichtet fühlte und in den 50er Jahren in das alte Museumsgebäude einziehen konnte. Anfang der 70er Jahre wurde der hintere Teil des Gebäudes abgerissen und durch einen umstrittenen Neubau ersetzt. Anfang der 90er Jahre wurde die historische Inneneinrichtung mit dem Treppenaufgang Henry van de Veldes teilweise rekonstruiert, und jüngst wurde ein mit einer Glashülle ummantelter rechteckiger Sichtbetonbau, das Emil Schumacher Museum, neben dem historischen Museum errichtet und mit ihm durch ein gemeinsames Foyer verbunden. Wer also heute das Osthaus Museum Hagen besucht, stößt auf ein heterogenes städtebauliches Ensemble. Nach dem Eintritt fällt einem im Foyer zunächst linkerhand eine langgestreckte Treppe auf, die die oberen Etagen des Emil Schumacher Museums erschließt. Eine schöne und großzügige Lösung. Wer ins Osthaus Museum will, muss dagegen durch einen niedrigen schlauchartigen Tunnel, dann ein kurzes Stück Treppe hinauf und dahinter in einem Gang nach rechts gehen, bevor man einen hohen fast leeren Raum betritt, an den sich das vielgerühmte Jugendstil-Treppenhaus anschließt. Dieses Entree ist architektonisch misslungen, ist hässlich. Auch das eigentliche Museum ist eine Enttäuschung, hat wenig Atmosphäre. Im Obergeschoss werden in einem schmalen Raum, Bildersaal genannt, Gemälde des deutschen Expressionismus gezeigt als Verweis auf die ursprüngliche Sammlung. Die bestand aber aus Werken von van Gogh, Gauguin, Cézanne, Manet, Matisse, Renoir, Rodin, Seurat und Signac. In einem anderen Raum, dem Sammler und Kunsthändler Alfred Flechtheim gewidmet, hängen Werke lebender Künstler. Beziehungen zwischen den Bildern und dem Leben Flechtheims haben sich mir nicht erschlossen. Am interessantesten war noch die Bibliothek mit der Installation „Ein kollektives Gedächtnis“ der Norwegerin Sigrid Sigurdsson. Dokumente, Fotos und Zeichnungen sind in dicken Folianten geordnet, das Blättern darin wird zum Abenteuer.
Dagegen bin ich vom K21, dem Ständehaus in Düsseldorf, sehr begeistert. Aus Gründen, die ich nicht recht erläutern kann, hatte ich einen Besuch nie in Betracht gezogen, bis meine Frau mit Bestimmtheit erklärte, sie wolle die begehbare Installation im Ständehaus sehen – ich könne sie begleiten oder es bleibenlassen. Nachdem mehrere ins Auge gefasste Termine platzten, haben wir es jetzt an einem sonnigen Sonntagmorgen geschafft. Den Umbau des vorher als Parlament benutzten Gebäudes halte ich für sehr gelungen, der überdachte weiße Innenhof mit den Treppentürmen erinnert an die Plätze Chiricos, die Umgänge in den oberen Geschossen bieten schöne Fotomotive an, und die Ausblicke über die Stadt sind viel intimer als vom weit höheren Fernsehturm. Ganz oben, unter der Glaskuppel hängt zur Zeit das Stahlnetz „In Orbit“ von dem argentinischen Installationskünstler Tomás Saraceno. Die Installation scheint beim Publikum sehr beliebt zu sein - schon zweimal wurde die Ausstellung verlängert. Da man das Netz nur im Overall und mit bestimmten Schuhen, die am Zugang bereitgehalten werden, betreten darf, ist leichte Bekleidung empfehlenswert. Außerdem sollte man für den Besuch auf Sonnenschein warten.
(Im März 2015)
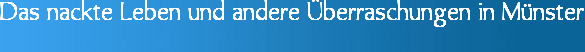
Das Landesmuseum in Münster hat einen nüchternen Erweiterungsbau aus den 70er Jahren durch einen postmodernen Neubau ersetzt, dessen öffentlicher Teil aus vier Höfen besteht, wobei sich zwei zur Stadt hin öffnen und einer das weitläufige und großzügige Foyer aufgenommen hat. Besonders markantes Bauteil ist ein Tortenstück, eine scharfe Spitze, die allerdings an Peis Erweiterung der National Gallery of Art in Washington erinnert und die man auch vom MMK in Frankfurt kennt. Abgesehen von einigen banalen, teilweise vom Altbau übernommenen Kunst-am-Bau-Applikationen an den Außenwänden halte ich den Neubau für sehr gelungen, vor allem auch, weil innen die Einbeziehung des Altbaus mit seinem schönen Treppenhaus im Stil der Neorenaissance gut gelöst wurde. Unterschiedlich geschnittene Fenster an verschiedenen Stellen erlauben einerseits Ausblicke auf den Dom und die Landsbergsche Kurie, einen dreiflügeligen Barockbau, der heute das geologische Museum beherbergt, und andererseits vielfältige Einblicke in das Museum.
Seine Neueröffnung feiert das Landesmuseum mit einer Ausstellung englischer Malerei, die zwischen 1945 und 1980 in London entstand. Gezeigt werden 120 Werke von 16 Malern, wobei Francis Bacon, David Hockney und Lucian Freud die bekanntesten Künstler sind und mit typischen Werken vorgestellt werden. Daneben sind auch Michael Andrews, Richard Hamilton, Allen Jones und R. B. Kitaj mit mehreren Gemälden vertreten. Diese Zusammenstellung ist originell und überrascht, weil, wie die NZZ in ihrem Bericht über die Ausstellung anmerkte, die Kunstgeschichte die Künstler üblicherweise in separate Schubladen steckt: Bacon, Freud und Andrews haben das Etikett „School of London“ erhalten, während Hamilton, Hockney, Jones und Kitaj der Pop-Art zugerechnet werden.
Das gemeinsame Band der ausgestellten Maler waren die Ablehnung des Zeitgeistes der Nachkriegsjahre, der Abstraktion verlangte, und ein Bekenntnis zur figurativen Malerei mit Themen aus dem Leben, mit Porträts, Akten, Interieurs, Landschaften und Stadtansichten von London. Warum Graham Sutherland in diesen Kreis nicht aufgenommen wurde, blieb mir allerdings rätselhaft.
Auch die Hängung der Ausstellung ist nicht leicht zu verstehen. Sie erfolgte weder chronologisch noch nach Künstlern, sondern nach sechs Gesichtspunkten wie z. B. „Die Wirklichkeit durchdringen“ oder „Realität und Materialität“, die weder im Kurzführer noch im Katalog so richtig erhellt werden. Diese kritischen Anmerkungen sollten jedoch niemanden vom Besuch abhalten – dazu ist die Ausstellung zu gut bestückt.
Eine weitere Überraschung dürften für jeden, der das Landesmuseum zum ersten Mal besucht, Qualität und Umfang der ständigen Sammlung sein. Nicht nur ist der deutsche Expressionismus exzellent vertreten, auch bei den alten Meistern sind Schätze zu entdecken. So hat das Museum ein halbes Dutzend Gemälde von Derick Baegert aus Wesel versammelt, der zu den wichtigsten Vertretern der niederrheinischen Malerei der Spätgotik gehört. Er ist heute kaum bekannt, weil nur ein kleiner Teil seines Werks die Zeitläufte überstanden hat, vermutlich wurde vieles in den Bilderstürmen zerstört. So existieren von einer großen Kreuzigung nur noch fünf Fragmente, die alle im Thyssen-Bornemisza-Museum in Madrid hängen, wo er mir auch zum ersten Mal aufgefallen ist. Besonders beeindruckend sind Ausdruckskraft und Individualität der Gesichter sowie die Feinheit der Detailzeichnung. Auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft scheint Baegart die Möglichkeiten der Bildkomposition und die malerischen Mittel souverän beherrscht zu haben.
Abschließend möchte ich noch auf die Malerfamilie tom Ring hinweisen. Die Malerfamilie stammte aus Münster und hat dort in der Mitte des 16. Jahrhunderts gewirkt. Von den im Landesmuseum gezeigten Werken ist vor allem das Familienbild des Grafen Rietberg bemerkenswert.
(Im Febr. 2015)
National Gallery. Ein Dokumentarfilm über die Nationalgalerie in London. Er zeigt das Innenleben der Galerie, aber auch die Außenwirkung, zeigt Bildbesprechungen für Erwachsene und für Kindergruppen und Reaktionen der Besucher, zeigt die Vorbereitung von Sonderausstellungen und Diskussionen über die Lichtführung. Man ist bei Restaurierungsarbeiten dabei und erlebt z. B. mit, wie Experten vor einem Bild von Watteau (La Gamme d'Amour) darüber diskutieren, ob die abgebildeten Noten eine spielbare Melodie ergeben oder nicht. Bei Rubens' Version von "Simson und Delila" erklärt eine sehr kompetente Führerin nuanciert Selbstzweifel und Abscheu in den Gesichtszügen Delilas und der Haltung ihrer Hände (eine Hand liegt auf dem Rücken Simsons, die andere ist abwehrend zurückgezogen), während die Kamera die unterschiedlichen Reaktionen mehrerer junger Frauen festhält, die Teil der Besuchergruppe waren. Und vor Holbeins Porträt der Prinzessin Christina von Dänemark erfährt man, dass sie den Heiratsantrag Heinrichs VIII. mit den Worten abgelehnt haben soll, wenn sie zwei Köpfe hätte, würde sie dem König einen schenken ... und zwischendurch erzählt ein Führer einen Witz über Moses und die zehn Gebote. Der Film zeigt, wie die FAZ geschrieben hat, wie Kunst durch Sprache in Erzählung verwandelt wird. Wunderbar. Wahnsinn. Ein Muss. Der Film dauert drei Stunden und läuft mit deutschen Untertiteln.
(Im Jan. 2015)
Von Jupiter Ascending, dem neuen Science-Fiction-Spektakel der Geschwister Wachowski, bin ich schwer enttäuscht. Die Wachowskis feierten 1999 mit dem Science-Fiction-Film „The Matrix“ den Durchbruch. Später machten sie mit „V wie Vendetta“ eine Comic-Adaption, die ein politischer Thriller war. Dann drehten sie 2012 mit Tom Tykwer „Cloud Atlas“ nach David Mitchells gleichnamigen Roman. Cloud Atlas gefiel mir sehr gut, der Film sprengt mit seinen sieben ineinander verschachtelten Geschichten eigenwillig alle Kategorien und gehört auch heute noch zu meinen Lieblingsfilmen. In „Jupiter Ascending“ steigt eine Putzfrau zur Herrscherin des Universums auf. Das daraus entstehende intergalaktische Abenteuer hat leider eine hanebüchene Handlung und ist nur Popcornkino mit vielen Verfolgungsjagden und Verballerung von noch mehr Munition – trotz der Beteuerung von Lana Wachowski, der Film sei auch eine Art feministisches Experiment, weil man eine weibliche Hauptfigur erschaffen habe, die sich nicht wie ein Mann benehmen müsse.
(Im Febr. 2015)
Alle Welt schreibt über die Aschenputtelgeschichte (Mädchen vom Land kriegt ihren Traumprinzen) Fifty Shades of Grey. TIME widmet dem Film sogar 7 Seiten. Felicitas von Lovenberg vergleicht ihn in der FAZ mit einem Wischmopp (in einem Text über Jenny Diski, die Ziehtochter von Doris Lessing: FSofG nimmt sich neben dem Roman „Nothing Natural“ aus wie ein Wischmopp neben einem Kaschmirplaid), aber den Vogel schießt D. Dath (ebenfalls in der FAZ) ab: Dieser Film kann nicht fesseln. Man könnte melancholisch werden, wenn man sieht, wie unterfordert Reitgerte, Lederfessel, Handschelle und Haarpeitsche ihren Daseinszweck verfehlen …
(Im Febr. 2015)
Auf Inherent Vice bin ich neugierig. Der Roman von Thomas Pynchon wurde von Paul Andersen verfilmt, der Magnolia gedreht hat, den Film, in dem es am Ende Frösche vom Himmel regnet. Inherent Vice sei, schreibt Verena Lueken in der FAZ, ein wahnsinniges Gewebe aus unüberprüfbaren Informationen, Stimmungen, Hinweisen, Schauplätzen, Albernheiten und Affekten … über Kalifornien in den Siebzigern, als die Zeit der Blumenkinder zu Ende war und Kokain Pot abgelöst hatte …
(Im Febr. 2015)

Unter der Überschrift „Wir leben im Zeitalter der Überforderung“ druckte die Rheinische Post in der Weihnachtswoche 2014 ein Interview mit Marion Ackermann, der künstlerischen Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ihre Kernaussage, wir lebten im Zeitalter der Überforderung, kann ich nicht nachvollziehen und betrachte die kulturelle Vielfalt eher als besonderes Privileg, jederzeit zwischen unterschiedlichsten Kunstangeboten auswählen zu können. Im Text des Interviews fand ich keine weitere Begründung, nur die kurze Aussage: „So glaubt man, dass man die Kunst der ganzen Welt wahrnehmen können soll.“ Ich glaube nicht, dass es irgendeine Person mit gesundem Menschenverstand gibt, die diese Forderung angesichts der Größe des vorhandenen Kunstuniversums ernsthaft vorbringt. Und selbst wenn es jemanden gäbe, der dieses Ansinnen stellte, so gibt es doch niemanden, der von sich behaupten kann, er sei in der Lage, diese Forderung zu erfüllen.
Im Verlauf des Interviews sprach Frau Ackermann über die Herausforderung der Digitalisierung und sagte, der digitale Raum als zusätzliches Museum sei eine Wende voller Herausforderungen. Die damit verknüpfte Befürchtung eines Besucherschwunds teile ich derzeit nicht. Virtuelle Museumsrundgänge und Angebote, wie sie Google mit dem Art Project ins Netz gestellt hat, sind eher Appetitanreger für einen Besuch, eine Betrachtung eines Kunstwerks vor Ort. Die Atmosphäre schöner Museen und die Wirkung, die Bilder in Originalgröße (z. B. Guernica oder Las Meninas) in ihrem Umfeld im Dialog mit anderen Kunstobjekten erzielen, können sie bislang nicht ersetzen. Stellt man sich aber eine Zukunft vor, in der der normale Bildschirm in einer Wohnung zwei Meter breit und ein Meter hoch ist und 10.000 oder mehr Pixel enthält, könnte der Besucherschwund aber Wirklichkeit werden. Um dann noch Besucher anlocken zu können, brauchen die Sammlungen wahrscheinlich extraordinäre Werke wie Guernica oder Las Meninas. Bei letzterem z. B. entsteht die stärkste Tiefenwirkung durch das Licht der im Hintergrund geöffneten Tür erst bei einem Betrachtungsabstand von ca. zehn Metern. Noch haben die Museen einen Vorteil, die sich im Internet besser und vollständiger präsentieren als andere und einen virtuellen Rundgang mit Ausschnittsvergrößerungen und einer Suchmöglichkeit verknüpfen. In Düsseldorf ist die Online-Präsentation der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen dürftig, der Zugang unverständlicherweise unter dem Wort „Entdecken“ versteckt, und bei einer flüchtigen Testabfrage ist mir aufgefallen, dass z. B. Max Ernst nicht vertreten ist. Wurden seine Bilder (Der Cocktailtrinker, Die schwankende Frau und Beim ersten klaren Wort) im Depot versteckt oder schon heimlich verkauft?
Die Zukunft neu ausgerichteter Museen, fuhr Frau Ackermann im Interview fort, sei eng verbunden mit der Frage nach der künftigen Rolle der Originalwerke … es sei notwendig, eine ethische Haltung einzunehmen. Leider sagte sie nicht, was ihre ethische Haltung dazu ist. Hier hätte ich erwartet, dass sie auf die Schrift „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ von Walter Benjamin eingehen und Stellung beziehen würde, ob sie die Fahne des Originals hochhalten will oder bereit ist, bei thematischen Ausstellungen auch mal Reproduktionen auszustellen, um Zusammenhänge besser erklären zu können. Ich bin durchaus für die Verwendung von Kopien, wenn die Originale nicht ausgeliehen werden können. Bei der Florenz-Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn vor einem Jahr z. B. klaffte in der Mitte ein großes Loch. Damit meine ich zeitlich die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts und das Fehlen von Gemälden der drei großen Manieristen jener Jahre: Bronzino, Pontormo und Rosso Fiorentino. Als ich am Ende einer Führung die Führerin daraufhin ansprach, erklärte sie mir, wichtige Originale seien leider nach Paris ausgeliehen, aber das Publikum würde das sowieso nicht bemerken! Es geht durchaus auch anders: In der derzeitigen großen Wiener Velázquez-Ausstellung hängt Las Meninas als Reproduktion.
An anderen Stellen des Interviews fand ich die Wortwahl unglücklich und missverständlich. So sagte sie z. B.: „Dazu kommt, dass man im Zeichen von Inklusion und Migration alle Menschen erreichen möchte.“ Ist das wirklich so? Wollte Frau Ackermann mit ihrem bisherigen Düsseldorfer Ausstellungsprogramm alle Menschen erreichen? Hab ich meine Zweifel. Ist es überhaupt möglich, mit Kunst welcher Art auch immer alle Menschen zu erreichen? Wollen die genannten Personengruppen überhaupt erreicht werden? Eine Flüchtlingsfamilie aus dem Irak z. B.? Die zur Zeit politisch vorangetriebene Inklusion hat viele problematische Facetten und eignet sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht als ein Argument im Zusammenhang mit der Frage der Darbietung von Kunst.
Dann ging es mit dem Satz weiter, an die zeitgenössische Kunst bestehe eine irreale Heilserwartung … Ich gestehe, dass ich den Sinn dieser Behauptung nicht verstehe. Den Begriff Heilserwartung verwende ich nur im religiösen Kontext. Welche Heilserwartung sollte z. B. mit einer Kopulationsplastik von Jeff Koons verknüpft sein? Immerhin zeigt die Wortwahl, dass sie dieser Heilserwartung kritisch gegenübersteht. Aber wie sie diesem irrealen Ansinnen entgegentreten will, sagen sie nicht. Sie hätte vielleicht besser über die Geldvermehrungserwartung gesprochen und zu den Praktiken des Kunsthandels Stellung bezogen.
Schade fand ich, dass Frau Bosetti von der RP in dem Interview eigentlich nur als Stichwortgeberin fungiert, aber nichts hinterfragt hat – die Ausstellungspolitik der letzten Jahre z. B. Im regionalen Vergleich steht die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf meiner Ansicht nach nicht besonders gut da. Den hervorragenden Ausstellungen „Der Sturm“ in Wuppertal, „Mission Moderne“ über den Düsseldorfer Sonderbund(!) in Köln, „Im Farbenrausch“ in Essen und „1914 - Die Avantgarden im Kampf“ in Bonn hatte Düsseldorf nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen.
Ob die Kunstsammlung NRW im Zirkel der Global Player mitspielt, wäre auch zu hinterfragen gewesen. Der Wettbewerb zwischen den großen Museen der Welt um die Gunst des Publikums erfolgt in Blockbuster-Ausstellungen wie die über Leonardo in der National Gallery in London 2011, über die Präraffaeliten als Viktorianische Avantgarde in der Tate London 2012 oder die schon erwähnte Wiener Velázques-Schau. All diese Ausstellungen sind aber flüchtige Ereignisse, das damit gewonnene Prestige muss immer wieder neu erarbeitet werden.
(Im Januar 2015)
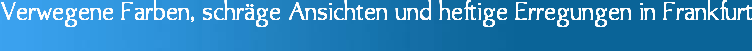
Fragt man im Bekanntenkreis nach deutschen Künstlern aus der Reformationszeit, erhält man meist Dürer und Cranach zur Antwort. Fragt man mit Hilfen nach (Alexanderschlacht, Isenheimer Altar, Heinrich VIII.), werden vielleicht noch Grünewald, Holbein und Riemenschneider genannt. Aber Albrecht Altdorfer, Bartholomäus Bruyn, Hans Burgkmair, Hans Baldung Grien, Wolf Huber, Jerg Ratgeb oder Veit Stoß sind keine geläufigen Namen.
Jetzt hat das Städel-Museum in Frankfurt über Albrecht Altdorfer und einige seiner vergessenen Zeitgenossen eine Ausstellung zusammengestellt, die eine eigenartige Epoche deutscher Kunst beleuchtet, die kurz nach 1500 plötzlich entstand, etwa vierzig Jahre währte und mehr oder weniger mit dem Tod Altdorfers endete. Obwohl ein Zeitgenosse Dürers, hat Altdorfer einen anderen Weg eingeschlagen, fast eine Gegenposition bezogen zu dessen an der Antike geschultem Figurenideal und zur kühlen Klassik der Hochrenaissance. Daher sind eine expressive Ausdruckssteigerung, ungewöhnliche Perspektiven, bewusste Grenzverletzungen, Verzicht auf Schönheit, grelle Farbzusammenstellungen und fantastische Beleuchtungseffekte die gemeinsamen Merkmale der ausgestellten Gemälde und Bildhauerarbeiten.
Gegliedert ist die Ausstellung in sechs Abteilungen, wobei jeweils Gemälde, Zeichnungen und Bildhauerarbeiten zusammen präsentiert werden. Merkwürdigerweise zeigt erst die zweite Abteilung mit dem Titel „Schräge Ansichten“ den chronologischen Anfang der expressiven Kunst um 1500. Begonnen hat nämlich alles mit zwei Kreuzigungen, die Lucas Cranach d. Ä. 1502 und 1503 in einem wilden Stil malte, bei denen die drei Kreuze nicht mehr traditionell frontal aufgestellt waren, sondern im Halbkreis oder in einem Dreieck zueinander mit starker Untersicht und einem tiefliegenden Horizont. In der zweiten dieser Kreuzigungen ist Christus sogar an den Bildrand versetzt und wird in Seitenansicht vor schwarzen Gewitterwolken gezeigt, während Maria und Johannes den Mittelpunkt des Gemäldes bilden. Altdorfer hat dieses Motiv später verwendet, ist aber auch immer wieder zur traditionellen Stellung der Kreuze zurückgekehrt. Einen Höhepunkt der Ausstellung bildet zweifellos in dieser Abteilung das 1535 entstandene Gemälde „Sündenfall und Erlösung“ von Georg Lemberger, einem Künstler, der mir bislang völlig unbekannt war. Das außergewöhnliche Bild besteht aus vielen unterschiedlichen Elementen und soll wohl die christliche Heilslehre darstellen. In der Mitte steht ein hoher Baum, der das Bild in zwei Hälften teilt. Die Krone ist rechts verdorrt und links belaubt. Die verdorrte Hälfte verweist auf das Alte, die linke Hälfte auf das Neue Testament. In der rechten Hälfte ist in einem Waldstück der Sündenfall dargestellt und darüber in einer dramatischen Wolkenformation die Übergabe der zehn Gebote an Moses. In der linken Hälfte entsprechen der Gesetzesübergabe die Verkündigung an Maria und dem Sündenfall die Auferstehung. Christus hängt in Seitenansicht an einem hohen Kreuz, ein Windstoß hat den überlangen Lendenschurz zu einer wehenden Fahne aufgebauscht, und unter dem Kreuz diskutieren gestenreich drei Männer.
Die dritte Abteilung ist den Landschaftsbildern gewidmet. Altdorfer und Huber haben immer wieder Landschaften um ihrer selbst willen gezeichnet oder gemalt – ohne sie nur als Hintergrund für biblische oder mythologische Szenen einzusetzen – und waren damit Wegbereiter einer eigenen Bildgattung. Ausgestellt ist unter anderem die bekannte „Flusslandschaft mit Burg“ aus der alten Pinakothek.
Aus der umfangreichen vierten Abteilung mit dem Titel „Mittel des Expressiven“ möchte ich nur ein Werk herausgreifen: die Apostelzone des Mittelschreins des ehemaligen Hochaltarretabels der Zisterzienserkirche in Zwettl von einem anonymen Meister. Nachfolgend übernehme ich dazu drei Sätze aus dem Katalog: „Auf engstem Raum zusammengepfercht drängen sich die Apostel um ein Buch auf dem leeren Grab Mariens. Außergewöhnlich ist die drastische Darstellungsweise von Emotionen, Gestik und Bewegung der Apostel mit ihren teilweise grotesk verzerrten Gesichtern, klauenhaft gekrümmten Fingern und verdrehten Körpern. Die verhärmten Gesichter … lassen nichts von den edlen Apostelgestalten (anderer) Renaissance-Künstler erahnen.“
Als dritten Höhepunkt der Ausstellung möchte ich aus der sechsten Abteilung mit dem Titel „Künstler und Auftragsgeber“ Altdorfers Porträt einer jungen Frau (vermutlich seiner Ehefrau) aus den Jahren 1520-25 herausstellen. Starke Farbkontraste verleihen dem Bild eine besondere expressive Ausdruckskraft und sind eine ästhetische Herausforderung. Vor einem giftgrün-schwarzen Hintergrund, dessen Stofflichkeit nicht erkennbar ist und schon auf El Greco verweist, sieht man die Frau im Halbprofil mit einem merkwürdigen, flüchtigen Lächeln – vielleicht wendet sie sich aus Schüchternheit ab, vielleicht ist sie auch stolz darauf, gemalt zu werden. Altdorfer hat sie in kaltes Licht getaucht und kontrastiert ein gelbes Kopftuch mit einem weißen Hemd, einem von Orange nach Türkis changierenden Kleid mit schwarzen Samtborten an Ärmeln und Brust und einem feuerroten Faltenrock.
Heute ist das Bild im Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid beheimatet. Besucht man es dort, lässt sich ein interessanter Vergleich anstellen – mit der zur gleichen Zeit gemalten „La Bella“ von Palma il Vecchio. „La Bella“ ist noch im Geist der Hochrenaissance gemalt. Man beachte die Eleganz der Stoffe, den rätselhaften Blick und die Haltung der Hände. (Im Anhang können beide Gemälde betrachtet werden.)
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass allein die zwölf Apostel und Altdorfers Porträt seiner Frau den Besuch in Frankfurt rechtfertigen: Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500. Im Städel Frankfurt; bis 8. Februar 2015.
(Im Dezember 2014)
Zu den aktuellen Ausstellungen gehört die spektakuläre Schau „Monet, Gauguin, van Gogh … Inspiration Japan“, die bis zum 18.1.2015 im Museum Folkwang in Essen zu sehen ist.
Mit dieser Ausstellung greift das Museum ein Thema auf, das seine Sammlungsgeschichte geprägt hat: Schon Karl Ernst Osthaus, der Gründer des Folkwangmuseums war von der Bildästhetik und Formensprache japanischer Kunst sowie deren künstlerischen Rezeption in Frankreich fasziniert.
Die Ausstellung präsentiert sich in zwölf thematischen Räumen, wobei mich besonders der dritte Raum „Bilder der fließenden Welt“ gefangengenommen hat. Hier wird die Entwicklung des japanischen Farbholzschnitts an zahlreichen Beispielen höchst nuancierter Farbigkeit und mit den besonderen japanischen Stilmitteln gezeigt. Die Andersartigkeit entsteht vor allem durch das Fehlen der Zentralperspektive, eine Flächigkeit ohne Tiefe, die diagonale Teilung des Bildes und eine asymmetrische, aus der Bildmitte zum Rand hin verlagerte Anordnung der Handlung, bzw. des Bildgegenstandes.
Raum fünf „Japonisme auf Papier“ führt die Wirkung vor, die die Bildästhetik japanischer Holzschnitte auf französische Druckgrafik und Plakatkunst hatte. Sehr schön auch eine Serie von Farbradierungen der Amerikanerin Mary Cassett.
Raum sechs versammelt unter dem Titel „Verinnerlichtes Japan“ bekannte Bilder der ersten Generation der Japonisten (Degas, Gauguin und van Gogh). Auch Cézanne (obwohl ein Japanverächter) ist mit mehreren Ansichten des Mont Sainte-Victoire vertreten. Offensichtlich stand der Berg Fuji Pate. Eine eigene Bildfolge gilt der Aufnahme der berühmten „großen Woge“ von Hokusai durch Courbet und andere Franzosen. Fahnenträger der Ausstellung ist van Goghs „Sämann bei Sonnenuntergang“ mit dem das Bild diagonal durchschneidenden Baumstamm. Schön wäre hier der Vergleich mit Gauguins „Jakobs Kampf mit dem Engel“ gewesen, das zur gleichen Zeit entstand, ebenfalls das Baumstammmotiv verwendet und durch die satten monochromen Farbflächen besticht. (So hat man einen Grund, nach Edinburgh zu reisen, um dieses frühen Meisterwerk von Gauguin zu sehen, mit dem er den Impressionismus schon weit hinter sich gelassen hat.)
Raum sieben zeigt Werke der Nabis (Bonnard, Denis, Ranson, Vallotton, Vuillard), und Raum zehn ist Monets Garten in Giverny gewidmet. Leider fehlt sein frühes Gemälde „Camille als Japanerin“. Das sollte jedoch kein Grund sein, auf einen Besuch des Museums Folkwang zu verzichten.
(Im November 2014)
Unter dem Titel „Die Kathedrale Romantik Impressionismus Moderne“ läuft bis zum 18.1.2015 im Wallraf-Richartz-Museum Köln eine Ausstellung mit ca. 150 Exponaten (Gemälden, Zeichnungen, Glasfenstern und Modellen), die der Kirchendarstellung in der Kunst gewidmet ist.
Was beim ersten Rundgang auffällt, ist die Hängung. Sie ist außerordentlich gut gelungen. Im zentralen mittleren Raum beispielsweise hängen an einer Wand fünf Versionen Monets der Kathedrale von Rouen und gegenüber von Sisley fünf Versionen der Kirche von Moret. In einem Eckraum, dem einzigen, der im WRM über ein Fenster verfügt und von dem man einen freien Blick auf den Kölner Dom hat, sind Gemälde des Kölner Doms versammelt. In einem anderen Raum hängen Feiningers Kirchenbilder aus Halle (darunter sein bestes Bild: die Marktkirche von Osten) nebeneinander, während gegenüber Rohlfs Soester Ansichten zu sehen sind, und den Rundgang beendet man in einem Raum, in dem sechs Versionen Lichtensteins der Kathedrale von Rouen mit fünf Versionen Warhols des Kölner Doms kontrastiert werden. Dazwischen bildet Gurskys Kathedrale, in der er aus Einzelbildern der Langhausfenster von Chartre eine Fensterfront schafft, wie es sie in dieser Form nie gegeben hat, einen beeindruckenden Abschluss der Ausstellung.
Was beim zweiten Rundgang auffällt, sind die Schwerpunkte der Ausstellung: Hauptsächlich handelt um Bilder, die nach 1800 gemalt wurden und gotische Kirchen (reale und Fantasien) zeigen. Es gibt Ausnahmen, z. B. einen Riss aus dem 13. Jahrhundert und eine Abbildung der geplanten Westfront des Kölner Doms aus dem Jahr 1654. Dabei fällt auf, was fehlt. Die großen Vorbilder fehlen, vor allem Jan van Eycks „Heilige Barbara (vor dem Turm des Kölner Doms)“, seine „Madonna in der Kirche“ sowie weitere ähnliche Werke mit Schrägsicht aus dem Umkreis von Robert Campin und Roger van der Weyden. Es fehlen die Kircheninnenräume der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, wie z. B. „Das Innere der St.-Bavo-Kirche in Haarlem“ von Pieter Saenredam, die halluzinatorischen Kircheninnenräume und -ruinen von François de Nomé (bekannter unter seinem Notnamen Monsù Desiderio) und von Alessandro Magnasco. Es fehlen Viollet-le-Ducs bekannte Zeichnung „Die Vollendung der Kathedrale von Reims mit sieben Türmen“, Corots „Kathedrale von Chartres“ und van Goghs „Kirche von Auvers“. Auch Moritz von Schwinds „Der Traum des Erwin von Steinbach“ wird nicht gezeigt.
Ein Blick in den Katalog hilft hinsichtlich der Bildauswahl nur bedingt weiter. In der Einleitung wird auf eine vorangegangene Ausstellung in Rouen Bezug genommen, und im Impressum steht der Hinweis, dass die Ausstellung dort unter dem Titel „Cathédrales 1789-1914, un mythe moderne“ zu sehen war – vermutlich also in einem engeren Rahmen und mit den Bildern der 1914 zerstörten Reimser Kathedrale als Abschluss. Auf der Internetseite des Museums der Schönen Künste in Rouen findet man folgende bemerkenswerte Einführung: “This exhibition project sets out to explore a theme which has never before been addressed: the place of Cathedrals in the artistic imagination and in the national debate, from Goethe and Victor Hugo to World War 1, against the historical background of Franco-German relations.”
Blättert man weiter, entdeckt man eine Kapitelgliederung, die stark vom Kölner Katalog abweicht und dem Kriegsgeschehen des Ersten Weltkrieges viel Aufmerksamkeit widmet.
Im Einleitungsteil des Kölner Katalogs wird auf das Erwachen der Mittelaltersehnsucht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die Begeisterung des jungen Goethe (seinen Text über die Westfront des Straßburger Münsters Von Deutscher Baukunst schrieb er 1772) und die Neubewertung der Gotik Bezug genommen. Aber warum die damals entstandene veränderte Sichtweise als moderner Mythos bezeichnet wird und warum der weite Bogen, den die Ausstellung schlagen will, erst um 1800 be-ginnt, will mir nicht recht einleuchten.
Trotzdem empfehle ich einen Besuch der Ausstellung. Auch wenn man die meistens Bilder schon irgendwo einmal gesehen hat, wird man sie in dieser Zusammensetzung und Gegenüberstellung wahrscheinlich nie wieder sehen können. Sicherlich macht jeder Besucher auch die eine oder andere Entdeckung. Ich zum Beispiel hatte den Riss von 1654 (im Katalog leider nicht enthalten) noch nie gesehen, und auch die Ansicht der Kathedrale von Laon von Max Ernst aus dem Jahr 1916 war mir völlig unbekannt.
(Im September 2014)

2014 war ein Jahr wichtigen Gedenktagen, wobei der 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs im Mittelpunkt des Erinnerns stand. Großen Raum nahm die Erörterung der Kriegsschuldfrage ein. In seinem 2012 erschienenen Werk „The Sleepwalkers“ hatte der australische Historiker Christopher Clark versucht, Deutschland zu entlasten. Dieser Auffassung wurde vielfach widersprochen, z. B. von Jörn Leonhard, der in seinem Buch „Die Büchse der Pandora“ die Berliner Sicht untersuchte und zeigte, dass Im deutschen Generalstab viele Annexionisten saßen, die weit in den Osten vorstoßen wollten, um wie Alexander der Große ein riesiges Reich zu erobern und neue Staaten zu errichten.
Meiner Ansicht nach begann die Weichenstellung in Richtung eines großen Krieges schon damit, dass Wilhelm II. den Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht erneuerte und sich anschließend auch noch mit seinem Flottenprogramm Großbritannien zum Feind machte, was schon vor der Jahrhundertwende in London zu dem Spruch führte, Germaniam esse delendam.
Neben diesem Thema verblassten andere Gedenktage wie der75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs oder wurden mehr oder weniger vergessen wie z. B. der 200. Jahrestag des Beginns des Wiener Kongresses, der 200. Geburtstag Johannas „Jenny“ von Westphalen, der späteren Ehefrau von Karl Marx, der 400. Todestag El Grecos und der 2000. Todestag des römischen Kaisers Augustus. Wie der Todestag des Augustus ging der Geburtstag der Ehefrau von Karls Marx unbemerkt von der Öffentlichkeit vorüber. Dabei hat eine neue Biographie von Angelika Limmroth Jenny als intelligente und eigenständige, aber auch biestige Frau dargestellt. Übrigens war ihr Stiefbruder Ferdinand von Westphalen preußischer Innenminister.
Dagegen erhielt der 1.200. Todestag Kaiser Karls des Großen viel Aufmerksamkeit, und die Stadt Aachen ließ es sich verständlicherweise nicht nehmen, eine große, ortsbedingt dreiteilige Ausstellung zu organisieren und an den Herrscher zu erinnern, dem sie ihre Bekanntheit verdankt.
Unter dem Titel „Orte der Macht“ erhält das Publikum im Krönungssaal des Aachener Rathauses den notwendigen Überblick zum Leben und Wirken Karls. Mit seinen Kriegszügen schuf er ein großes Reich und verdoppelte die Fläche, über die sein Vater Pippin geherrscht hatte. Er unterwarf die Sachsen, Bayern, Langobarden und Awaren und musste danach seine Herrschaft durch Umherziehen ausüben und festigen. Deshalb wurde in seinem Reisekönigtum ein klappbarer Bronzethron jeweils zum aktuellen Ort der Macht. Bischöfe und Äbte, Grafen und hohe Adelige mussten den König mitsamt großem Gefolge beherbergen. Daneben gab es Pfalzen und Königshöfe als Reisestationen, für die Landwirtschaft und Handwerk die notwendigen Lebensgrundlagen erwirtschafteten.
Durch die Feldzüge erweiterte der König sein Wissen. Er zog auch nach Ravenna und Rom, sah das Grabmal Theoderichs, hörte Berichte über die Bauten in Konstantinopel und über die Paläste der Kalifen. Das Gesehene und Gehörte setzte Karl in seinen Bauprojekten um. So entstanden die Pfalzen in Ingelheim, Nimwegen, Paderborn und in Aachen.
Von den ausgestellten Objekten stammt nur ein kleiner Teil aus der Zeit Karls, viele entstanden später oder sind Kopien (wie die Reichskrone, einer Kopie aus dem Jahr 1915). Aber darauf kommt es nicht unbedingt an, wenn man den Geist der Zeit wachrufen oder illustrieren will.
Im Stadtmuseum sind dagegen unter dem Titel „Karls Kunst“ bedeutende Objekte der Kunstgeschichte der Karolingerzeit, vor allem Werke der sogenannten Aachener Hofschule im Original zu sehen: kostbar illustrierte Handschriften, feine Elfenbeinschnitzereien und Goldschmiedearbeiten, die möglicherweise Karl selbst in Auftrag gegeben hat.
In der Domschatzkammer als drittem Ausstellungsort werden unter dem Titel „Verlorene Schätze“ wertvolle Teile des Kirchenschatzes gezeigt, vor allem Stoffe und Textilien sowie ein römischer Sarkophag aus dem dritten Jahrhundert, in dem der Kaiser bestattet worden sein soll. Die Sammlung liturgischer Textilien ist trotz großer Verluste im 19. Jahrhundert sehr umfangreich und darauf zurückzuführen, dass der Dom zu Aachen viele Reliquien besaß und bis zum Jahr 1531 (der Krönung Karls V.) Krönungsort der deutschen Könige war.
Die Aachener Ausstellung wurde in der Presse teilweise sehr kritisch aufgenommen. Hier ein Beispiel aus der FAZ: "Die im Katalog gerühmte Ausstellung im Rathaus ist fast schon grauenhaft zu nennen. Eine Kakaphonie aus Computersimulationen, Videos, Modellen und Faksimiles übertönt fast vollständig die kostbaren Originale, die nirgendwo die Chance haben, für sich selbst zu sprechen." Dann wurde als Beispiel die berühmte Leidener Aratea-Handschrift genannt, die irgendwo am Rande ohne Hinweisschild auf Inhalt und Entstehung liegt.
(August 2014)
Wer nach mehrjährigem Umbau das wiedereröffnete Reichsmuseum Amsterdam besucht und sich noch an den alten engen und dunklen Eingang erinnert, wird von neuer Großzügigkeit überrascht. Der Zugang erfolgt jetzt durch den Innenhof, dessen Boden neun Meter abgesenkt wurde und in den man über breite Treppen hinabsteigt, die man ihrerseits durch das alte Kuriosum der durch das Gebäude führenden Straße betritt – einer Straße, für deren Erhalt die Amsterdamer Radfahrer das höchste Gericht des Landes anriefen und Recht bekamen. Der weite Innenhof erhielt eine Glasdecke - ähnlich wie sie schon im British Museum in London, im Museum der schönen Künste in Boston und ansatzweise im Albertinum in Dresden verwirklicht wurde. Vom Innenhof führen mehrere Eingänge in verschiedene Teile des großen Museums, das jetzt über vier Ausstellungsgeschosse verfügt. Durch die hinzugewonnene Ausstellungsfläche wurden auch die Anordnung der Objekte verändert und die frühere strenge Trennung zwischen Gemälden und Kunsthandwerk aufgegeben. Im Untergeschoss wird jetzt Kunst des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts gezeigt, im Erdgeschoss das 18. Und 19. Jahrhundert, im ersten Obergeschoss das 17. Jahrhundert, und das Dachgeschoss beherbergt Werke des 20. Jahrhunderts. Diese den Besucher zunächst verwirrende zeitliche Anordnung ist dem Bauwerk zuzuschreiben, weil sich das Prachtgeschoss mit großer Vorhalle und Ehrengalerie im ersten Obergeschoss über der Durchgangsstraße befindet und dem Sammlungsschwerpunkt mit der Nachwache als zentralem Kunstwerk vorbehalten blieb.
An den Sammlungsschwerpunkten oder an den Lücken lässt sich leicht erkennen, dass die nördlichen Niederlande im 15. und 16. Jahrhundert noch der arme Bruder der wohlhabenden Provinzen Flandern und Brabant waren. Hier spielte die „kaufmännische“ Musik, während der durch Handel entstehende Wohlstand erst im 17. Jahrhundert den Norden erreichte. Entsprechend sind die Meister des 15. Jahrhunderts Jan van Eyck, Robert Campin, Rogier an der Weyden, Hugo van der Goes, Gerard David usw. nicht vertreten. Eine nennenswerte Ausnahme bildet lediglich „Die Heilige Sippe“ des jung verstorbenen Geertgen tot Sint Jans. Auch italienische Kunst ist nicht mit großen Werken zu sehen. In Erinnerung blieben mir nur ein Doppelporträt von Piero de Cosimo, eine sehr schöne Maria Magdalena von Carlo Crivelli sowie eine eindringlich geschnitzte lebensgroße stehende Maria einer Verkündigungsgruppe eines mir unbekannten Künstlers. Maria trägt ein langes rotes, unter der Brust gegürtetes Kleid und sieht den Betracht mit großen Augen ernst und leicht traurig an, als wisse sie, was sie erwartet. Ergreifend, großartig!
Für das 16. Jahrhundert ist Ähnliches zu vermelden: Bosch, Patinir, Pieter Brueghel, Marten van Heemskerck Fehlanzeige, von niederländischer Renaissance und vom Manierismus gibt es nur Häppchen. Immerhin ist ein Hauptwerk von Lucas van Leyden (Tanz um das goldene Kalb) und noch eine schöne Maria Magdalena (diesmal von Jan van Scorel) zu sehen.
Verlässt man das Untergeschoss, wird man zu ebener Erde ins 19. Jahrhundert geworfen. Hier begann auch unsere Führung, wobei die Führerin vor den (mir bislang unbekannten) Amsterdamer Impressionisten verweilte und einen langen Vortrag über George Breitner, seine Stadtbilder und ungewöhnlichen Bildausschnitte hielt. Den Rest des Jahrhunderts ersparte sie uns (zu Recht) und schritt zur Vorhalle der Ehrengalerie empor. Ihr detaillierter, kenntnisreicher Vortrag über das Schicksal der Vorhalle war außerordentlich interessant. Im 19. Jahrhundert im Geschmack der Zeit historistisch ausgestattet und ausgemalt, gerieten die Ausstattung und die Gemälde im Lauf des 20. Jahrhunderts immer mehr in Misskredit, wurden verdeckt, übermalt oder abgenommen, bis ein kahler Raum entstanden war. Für die Renovierung besann man sich eines Besseren und versetzte die Halle mit großem Aufwand in den ursprünglichen Zustand zurück. Jetzt ist sie ein Schmuckstück – der schönste Raum des Museums.
An die Vorhalle schließt sich die Ehrengalerie an, an deren Ende man schon die Nachtwache erblicken kann – oder zumindest die oberen Teile davon, weil sie von Besucherscharen durchgehend belagert wird. Zuvor jedoch sind links und rechts mehrere bekannte Bilder zu sehen, die alle längst in die Kategorie der Gemäldesuperstars aufgestiegen sind, z. B. Vermeers Magd mit der Milchkanne, Rembrandts Judenbraut, Hals‘ Fröhlichen Trinker sowie mehrere Bilder von Jan Steen und Pieter de Hooch. Auch Ruisdaels Mühle bei Duurstede sollte hier hängen, war aber nicht ausgestellt. Unsere Führerin verweilte bei mehreren dieser Gemälde. Leider sprach sie ohne Audiosystem, und da zur gleichen Zeit mindestens zehn andere Gruppen von ihren Führern in unterschiedlichen Sprachen Erläuterungen erhielten, war der Lärm einem entspannten Zuhören sehr abträglich. Ich jedenfalls entzog mich diesem Gedränge und wanderte durch die stilleren Nebenräume. Welche Erklärung unsere Führerin zur Popularität der Nachtwache gab, ist mir deswegen entgangen.
Fazit: Wer die Gemälde, die das Reichsmuseum berühmt gemacht haben, in Ruhe betrachten möchte, sollte sich schon zu Öffnungsbeginn am Eingang einfinden und schnurstracks in die erste Etage steigen. Dann hat er vielleicht eine halbe Stunde Zeit, bevor dort das große Gedränge einsetzt.
(Im Juni 2014)
In unregelmäßigen Abständen lese ich Interseiten der Neuen Zürcher Zeitung, um ihre Meinung zu politischen und kulturellen Ereignissen mit den Urteilen deutscher Zeitungen und Magazine zu vergleichen. Dabei stieß ich kürzlich zufällig in der Rubrik „Literatur und Kunst“ auf eine Bildbeschreibung des kleinen Gemäldes „Der Liebeszauber“, das von einem unbekannten, vermutlich niederrheinischen Künstler in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gemalt wurde und heute im Museum der bildenden Künste in Leipzig hängt. Das Bild zeigt eine spätgotische Wohnstube mit Holzfußboden, Truhe, Wandschrank und Kamin, in dem ein Feuer brennt. Tageslicht fällt durch mehrere Fenster und gibt viele Einzelheiten der Einrichtung preis, z. B. kostbares Hausgerät im geöffneten Wandschrank. Durch eine geöffnete Tür im Hintergrund scheint gerade ein junger Mann in die Stube treten. Er verharrt jedoch im Türrahmen und blickt wie gebannt auf ein junges Mädchen, das in der Mitte des Raums neben einem Schemel steht und den Eindringling noch nicht bemerkt hat. Auch ein kleiner Hund im Vordergrund, ein weißer Pudel, scheint den Mann noch nicht bemerkt zu haben, wenigstens liegt er dösend und entspannt auf einer Decke zu Füßen des Mädchens. Das Mädchen ist nackt, nur mit Schuhen bekleidet und träufelt Wassertropfen aus einem Schwamm auf ein Herz aus rotem Wachs, das in einem Kästchen auf dem Schemel liegt. Gleichzeitig schlägt es Funken aus einem Feuerstein, die mit den Tropfen auf das Herz fallen.
Auch nach längerem Betrachten öffnet sich der Sinn des Bildes zunächst nicht. Zweifelsfrei aber steht es in der Tradition Jan van Eycks und nimmt Motive zweier berühmter Gemälde auf: der Arnolfini-Hochzeit und des Doppelporträts seiner Frau in der Badestube, das heute nur in der Kopie Willem van Haechts aus dem Jahr 1628 erhalten ist, die im Rubenshaus in Antwerpen hängt. Aus der Arnolfini-Hochzeit sind der kleiner Hund im Vordergrund, die Schnabelschuhe und ein gewölbter Spiegel übernommen. Aus dem Doppelporträt möglicherweise die Raumperspektive und die Haltung des Mädchens mit leicht geneigtem Kopf. (Auch Schnabelschuhe und Spiegel waren im Doppelporträt vorhanden.)
Über dieses Bild hat der in Köln lebende Schriftsteller Navid Kermani ein äußerst abfälliges Urteil gefällt. Für ihn ist das junge Mädchen eine Hure, die auf ihren nächsten Galan wartet. Der Hund bleibt ruhig, weil er mit Männerbesuch bei seinem Frauchen(!) vertraut ist und ihn schlafend toleriert, und selbst die Schnabelschuhe werden dem Sadomaso-Bereich zuordnet. Dieser Text ist nicht nur indiskutabel, er ist dumm. Kermani hat nicht die geringste Ahnung, worum es in dem Bild geht. Hätte er ein wenig recherchiert oder sich jemals zuvor mit Symbolen des Mittelalters beschäftigt, hätte er zumindest gewusst, dass der kleine Hund im Vordergrund als uraltes Symbol ehelicher Treue galt und dass Jan van Eyck sicherlich nie ein Bildnis seiner eigenen Frau mit Symbolen der Prostitution versehen hätte. Noch schlimmer aber finde ich, dass es offenbar in der Redaktion der NZZ niemanden gab, der die Urteilskraft besaß, den vorgelegten abstrusen Text zurückzuweisen.
Tatsächlich erzählt das Bild ein Ritual, einen Volksbrauch des späten Mittelalters, der am 30. November, dem Andreastag, ausgeübt wurde. Das Mädchen, das Wassertropfen aus einem Schwamm auf ein Herz aus rotem Wachs träufelt und gleichzeitig Funken aus einem Feuerstein schlägt, die mit den Tropfen auf das Herz fallen, ist in eine Beschwörung vertieft. Wenn der Zauber gelingt, erscheint der zukünftige Liebste, und auf dem Bild tritt er gerade durch die Tür. Diesen Sachverhalt hat schon vor vierzig Jahren Gottfried Sello beschrieben, als im damaligen Westdeutschland niemand mehr dieses bezaubernde spätgotische Meisterwerk kannte, weil es unerreichbar in Leipzig in der DDR hing.
Übrigens handelte es sich bei Eycks Doppelporträt vermutlich um die erste profane Darstellung einer Nackten in der europäischen Tafelmalerei. Entsprechend könnte das Mädchen im Liebeszauber die erste profane Nackte gewesen sein, die im Rheinland gemalt wurde.
(Im April 2014)

Obwohl Balthus deutsch-polnische und deutsch-jüdische Wurzeln hat, obwohl Rilke über viele Jahre ein enger Freund seiner Mutter war und obwohl er sich mit einem eigenständigen, wenn auch umstrittenen Werk in die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben hat, wurde ihm bislang in Deutschland nur eine einzige Ausstellung gewidmet (2007 in Köln). Auch in den Sammlungen deutscher Museen ist er nicht vertreten. Daher dürfte die Nachricht, das Museum Folkwang in Essen habe eine geplante Ausstellung von Fotografien junger Mädchen wegen Pornografieverdachts abgesagt, die Öffentlichkeit überrascht oder ratlos gelassen haben.
Von Balthus habe ich meiner Erinnerung nach zum ersten Mal Mitte der 70er Jahre ein Gemälde gesehen und zwar in einem von David Larkin herausgegebenen Kunstband, der in jenen Jahren eine ganze Reihe schmaler Kunstbände mit Bezug zu phantastischer Kunst herausbrachte. Der Band hatte den Titel „Temptation“ und versammelte Bilder von Jan van Eyck bis zu zur Pop Art. Das Gemälde von Balthus trug den Titel „Das Zimmer“, wurde später in Publikationen „Die schönen Tage“ genannt, und kürzlich fand ich es im Internet unter dem Titel „Die goldenen Jahre“. Man sieht darauf ein junges Mädchen auf einer Chaiselongue, im Hintergrund rechts kniet eine kantige männliche Figur mit nacktem Oberkörper vor einem Kamin und schürt das Feuer. Das Mädchen hat das rechte Bein bis zum Boden ausgestreckt und lässt den rechten Arm entspannt baumeln, wodurch der Träger ihres Kleides über die Schulter geglitten ist. Das linke Bein ist angewinkelt, der Fuß ruht auf dem Polster, das Kleid ist weit nach oben verrutscht und erlaubt dem Mann, ihr unter den Rock zu blicken, sobald er sich umwendet. In der linken Hand hält das Mädchen einen Spiegel und scheint sich darin zu betrachten. Ihr Gesichtsausdruck wirkt entspannt, sie scheint mit dem, was sie erblickt, zufrieden zu sein. Außerdem scheint sie weder den Mann noch die gespreizte Stellung ihrer Beine zu beachten. Ihr Alter ist unbestimmt, sie könnte 14 Jahre oder auch schon 17 sein. Farblich dominieren ein mattes Rostrot und ein dunkles, in Schwarz übergehendes Grün das gesamte Bild. Das Kleid, der Rücken des Mannes und Teile des Kamins sind in Rostrot gehalten, der Fußboden, die Chaiselongue und Teile der rückwärtigen Wand sind abgestuft grünschwarz. Als dritte Farbe kommt ein pointiert gesetztes schönes Gelb hinzu: für die Pantoffel, den Rahmen des Spiegels und die Flammen. Beine und Gesicht des Mädchens werden nicht vom Feuer im Kamin beleuchtet, sondern von links, von der anderen Seite. Aus einem angrenzenden Zimmer hinter einem zurückgezogenen Vorhang fällt Licht in das Kaminzimmer. Woran denkt man beim Betrachten des Bildes? Im Hinblick auf den Lichteinfall an Bilder des Barocks, an Caravaggio, Georges de la Tour und Zeitgenossen. Dann aber fällt auf, dass die Teile des Bildes nicht recht zueinander passen, die scheinbare Entspanntheit steht im Widerspruch zur Künstlichkeit der Haltung des Mädchens und des wie mit einer Schablone gezeichneten Mannes. Es ist völlig unklar, in welcher Beziehung die beiden Personen zueinander stehen. Was assoziiert man? Alles Mögliche, literarisch vielleicht Fräulein Julie von August Strindberg oder Lolita. Auf jeden Fall behält man „Die schönen Tage“ als ungewöhnliche Komposition und den Namen des Malers im Gedächtnis.
Ein paar Jahre später bekam ich mehr von Balthus‘ Bilderwelt zu sehen. 1981 zeigte das Centre Pompidou in Paris die kapitale Ausstellung „Les Realismes 1919-1939“. Es war eine Jahrhundertausstellung, die anschließend unter dem Titel „Realismus zwischen Revolution und Reaktion“ auch für kurze Zeit in Berlin lief. Die die Serie der großen Bilanzen (Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moskau) fortsetzte und dem Mythos der abstrakten Malerei als Avantgarde der Kunst den Todesstoß versetzte. In dieser Ausstellung war auch Balthus mit fünf Bildern vertreten, seinen Hauptwerken „Die Straße“ und „Im Gebirge“, außerdem mit einer Nackten und zwei Porträts. Eines der Porträts zeigt André Derain und muss aus heutiger Sicht sehr kritisch betrachtet werden. Derain steht in einem gestreiften Morgenmantel und mürrischem Gesicht frontal vor dem Betrachter. Er ist ein Berg von einem Mann, wirkt sehr unsympathisch und hat Tränensäcke unter den Augen. Eine Hand hat er flach auf seine Brust gelegt, als wolle er sagen: „Es ist nichts passiert, ich habe gar nichts gemacht.“ Seitlich hinter ihm sitzt nämlich stark verkleinert ein sehr junges Mädchen in einem für die Zeit (das Bild wurde 1936 gemalt) sehr kurzen Rock auf einem Stuhl und blickt nach unten. Ihr trägerloses Hemd ist verrutscht, eine Brust fast entblößt. Ihr Mund deutet ein träumerisches Lächeln an, als wolle sie auf eine erotische Komplizenschaft hinweisen. Mir kommt vor, als spiele Balthus mit dem Betrachter und benutze verschiedene Mittel, um Unsicherheit und Zweifel bezüglich der Situation hervorzurufen. Dazu gehören die Größendiskrepanz zwischen Derain und dem Mädchen, die Unterschiede im Gesichtsausdruck und die Raumausstattung. Das Zimmer ist leer, im Hintergrund sieht man nur eine Staffelei und Bilderrahmen, aber kein Bett. Aber wie wir alle wissen, braucht man für sexuelle Akte kein Schlafzimmer. Man könnte sich dieses Bild als eine TAT-Vorlage (eine Vorlage im Thematischen Apperzeptions-Test, einem psychologischen Testverfahren) vorstellen. Interessanterweise war dieses Gemälde im Ausstellungskatalog der Einleitung vorangestellt, als sei es das Motto für alles, was folgt. Für mich nicht nachvollziehbar, eine Begründung im Text habe ich nicht gefunden. Vielleicht gab es im Leben Derains ein besonderes Ereignis, das diese Herausstellung rechtfertigt, vielleicht muss man Franzose sein, um die Zusammenhänge zu verstehen.
Von September 2001 bis Anfang Januar 2002 wurde im Palazzo Grassi in Venedig eine große, rund 160 Gemälde und Zeichnungen umfassende Ausstellung gezeigt. Abgesehen von „Im Gebirge“ und dem „Mädchen im weißen Rock“ waren alle wesentlichen Werke zu sehen, auch das letzte, unvollendete Gemälde, an dem Balthus bis kurz vor seinem Tod gearbeitet hatte, ein sehr schönes und farblich überragend komponiertes Bild eines Mädchens mit einem Spiegel und einer Katze. Besonders interessant ist der Katalog, weil er sich mit den Vorbildern beschäftigt und z. B. zeigt, dass Balthus für die Personen, die auf dem Bild „Die Straße“ zu sehen sind, Figuren von Piero della Francesca, Masaccio und Heinrich Hoffmann (Zeichnungen aus „König Nussknacker“) verwendete. Bei anderen Gemälden wurden Vorzeichnungen neben die Ausführung gesetzt, und verblüfft stellt man fest, dass die Vorzeichnungen detailgenau richtige Körperproportionen enthielten und die typischen Verzerrungen, Vergrößerungen der Köpfe sowie versetzte Halsanschlüsse den Gemälden vorbehalten blieben.
Die Kölner Einzelausstellung im Jahr 2007 umfasste rund 70 Gemälde und Zeichnungen, vorwiegend aus der Zeit zwischen 1932 und 1960. Dabei gelang ein Kunststück, das in Venedig nicht gelungen war, zwei Bilder zusammenzubringen, die man meines Wissens vorher nur einmal zusammen sehen konnte (1981 in „Les Realismes 1919-1939“), nämlich „Die Straße“ und „Im Gebirge“. Beide hängen in N. Y., aber eins im Moma und das andere im Metropolitan. Die Besprechungen der Kölner Ausstellung waren verhalten, die Bilder der jungen Mädchen riefen Unbehagen hervor, man merkte, dass die Rezensenten nicht recht wussten, wie sie mit der Voyeurismus- und Lolita-Thematik umgehen sollten. Die malerische Qualität der Bilder wurde unterschlagen.
Zurück zum Anfang: Warum das Museum Folkwang in Essen angesichts der Missbrauchsaffäre in der Odenwaldschule, der Entzauberung des Reformpädagogen Hartmut von Hentig, der Skandale in Organen der katholischen Kirche, des Aufarbeitungsbedarfs bei den Grünen, der Verwürfe gegenüber dem Abgeordneten Edathy und der allgemein erhöhten Sensibilität für das Thema Kindesmissbrauch eine Balthus-Ausstellung ausschließlich mit Aktfotografien von jungen Mädchen plante, kann man eigentlich nicht verstehen. Hätte man stattdessen das Thema „Balthus und seine Quellen“ gewählt und dem erstaunten Publikum u. a. den Verfasser des Struwelpeters als Motivgeber vorgestellt, hätte man auch einige der Polaroid-Fotos einbeziehen können, um die dann wenig Aufhebens gemacht worden wäre. Man sollte nicht vergessen, dass jeder Mensch ein Kind seiner Zeit ist und dass für die Entwicklung von Balthus die frühen dreißiger Jahre entscheidend waren. Den Zeitgeist in Paris erfasste die Zeitschrift „Minotaure“, in der z. B. 1935 Aktfotos junger Mädchen von Paul Eluard abgedruckt waren.
Der eigentliche Skandal um Balthus besteht darin, dass kein deutsches Museum eins seiner Bilder angekauft hat.
(Im Febr.2014)
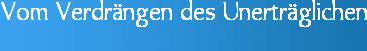
Nach einer Autorenlesung, die in einem Berliner Fernsehstudio aufgezeichnet wurde, trafen sich Freunde der Autorin in größerer Runde zu einem späten Abendessen. Meine Tischnachbarin war eine Berliner Malerin, und im Verlauf des Abends sprachen wir über alle möglichen Themen. Schließlich erwähnte sie den Dokumentarfilm "Die Wohnung" und legte ihn mir sehr ans Herz. Ich sollte ihn mir unbedingt ansehen, falls sich die Gelegenheit ergäbe. Es ginge darin um eine Wohnungsauflösung in Tel Aviv, bei der der Enkel Briefe seiner verstorbenen Großeltern entdeckte, die ihn zu weiteren Nachforschungen in Deutschland veranlasst hätten.
In den Programmkinos war der Film schon vor einem Jahr gelaufen, aber vor ein paar Tagen (ein halbes Jahr nach dem Abendessen in Berlin) wurde der Film von arte ausgestrahlt.
Der Film beginnt mit der Wohnungsauflösung der im Alter von 98 Jahren verstorbenen Gerda Tuchler, die aus Berlin stammte, etwa 70 Jahren in Tel Aviv gelebt hatte und die Großmutter des Dokumentarfilmers Arnon Goldfinger war. Er erzählt, dass er sie früher oft besucht hat, dass er aber über das Leben der Großeltern in Deutschland nichts weiß („über die wirklich wichtigen Dinge hat Großmutter geschwiegen“) und nicht einmal das Geburtsjahr seines vor dreißig Jahren verstorbenen Großvaters Kurt Tuchler kennt. Auch seine Mutter, die ihm beim Ausräumen hilft, weiß nichts über die Familiengeschichte – obwohl sie noch in Berlin zur Welt gekommen ist. Sie habe die Großmutter nie danach gefragt, sie habe sich nie dafür interessiert, und die Großmutter habe auch nichts erzählt. Eine Erklärung für ihre Interessenlosigkeit kann sie ihrem Sohn nicht geben, seine Fragen sind ihr sichtlich unangenehm, und sie zuckt nur abweisend mit den Schultern oder verzieht ihren Mund. Dann aber findet sie zwischen alten Ausgaben des Gemeindeblatts der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ein Exemplar der NSDAP-Zeitung „Der Angriff“ aus dem Jahr 1934 mit einem Reisebericht unter dem Titel „Ein Nazi fährt nach Palästina“. Mutter und Sohn fragen sich, warum die Großeltern diesen Zeitungsartikel aufgehoben hatten, als dessen Verfasser ein ihnen völlig unbekannter Leopold von Mildenstein genannt wurde.
In einem israelischen Privatarchiv zum Thema „Nationalsozialismus und Palästina“ erfährt Goldfinger, dass der Journalist Mildenstein im Jahr 1933 eine längere Palästinareise unternommen und über diese Reise 1934 eine prozionistische Artikelserie im „Angriff“, der sonst als eine der übelsten Nazizeitungen galt, veröffentlicht hat. Kurt Tuchler, den Goldfinger als deutschen Patrioten, aber auch als glühenden Zionisten charakterisiert, hatte ihn auf dieser Reise im Auftrag der Deutschen Zionistischen Vereinigung begleitet, weil sich hier die Interessen der Nationalsozialisten und der Zionisten deckten: Die Nazis wollten die Juden loswerden, und die Zionisten träumten von einem eigenen Staat in Palästina.
Aus unzähligen Briefen, alten Fotos, anderen Dokumenten, Filmausschnitten des Prozesses gegen Adolf Eichmann und zwei Reisen nach Deutschland setzt der Dokumentarfilmer nach und nach das Puzzle „Wer war Mildenstein und in welcher Beziehung stand er zu meinen Großeltern?“ zusammen.
Leopold von Mildenstein trat 1929 in die NSDAP ein und war seit 1932 Mitglied der SS. Nach der Veröffentlichung seines Reiseberichts galt er in der Partei als Experte für die Levante, leitete das Judenreferat und vertrat die offizielle Parteilinie, die Juden Deutschlands sollten zur Auswanderung nach Palästina veranlasst werden. In der Zeit holte er Adolf Eichmann in die Abteilung, der sie später in der bekannten Weise ausbaute. In seinem Prozess erklärte Eichmann 1961, Mildenstein sei sein Meister und Vordenker gewesen, er habe nach einer politischen Lösung der Judenfrage gesucht. Bedauerlicherweise wurde Eichmann in seinem Verhör nicht die Frage gestellt (zumindest nicht in dem im Film gezeigten Abschnitt), ob er wisse, welche Tätigkeit Mildenstein in den späteren Jahren des Dritten Reiches ausgeübt habe, und in einem Kommentar hält Goldfinger fest, dass er über die Kriegsjahre Mildensteins immer noch im Dunklen tappe. (Daher kann man annehmen, dass Eichmann nicht weiter über Mildenstein befragt worden war.) Dagegen findet er bei der Sichtung alter Fotos heraus, dass die Ehefrauen ihre Männer auf der Palästinareise begleitet und Freundschaft geschlossen hatten. Auch nach dem Ende der Reise und in den folgenden Jahren blieben die Ehepaare befreundet, obwohl Kurt Tuchler bei der Rückkehr seine Entlassung vorfand: Die Nationalsozialisten hatten ihn seines Richteramtes enthoben. Trotz der Entlassung und trotz der zunehmenden Repressalien verließen die Tuchlers Deutschland erst im Jahr 1937, korrespondierten aber nach ihrer Auswanderung nach Palästina noch mindestens bis zum Jahr 1939 mit den Mildensteins.
Bei der weiteren Sichtung der Briefe fällt Goldfinger ein Briefumschlag aus den Nachkriegsjahren mit einer Absenderangabe aus Wuppertal auf. Er beschafft sich die Telefonnummer, ruft an und kommt zu seiner Überraschung mit Edda von Mildenstein, der Tochter des inzwischen verstorbenen Ehepaares, in Kontakt. Sie ist am Telefon sehr freundlich und lädt ihn ein, sie zu besuchen. Er kommt der Einladung nach und reist nach Deutschland. Die etwa 70jährige Edda Mildenstein erzählt ihm, dass ihre Eltern schon während ihrer Kindheit oft von Tuchlers gesprochen haben, dass Tuchlers einmal zu Besuch kamen und ihr sogar eine schöne Kette geschenkt haben. Auf die Frage, was ihr Vater während des Krieges gemacht habe, erklärt sie, er sei im Ausland gewesen, erst in Amerika, dann in Japan. Nach einer Auseinandersetzung mit Heidrich habe er seine Stelle im SD der SS aufgegeben und habe wieder als Journalist gearbeitet. In den 50er Jahren habe eine englische Zeitung behauptet, er habe im Propagandaministerium unter Goebbels gearbeitet, aber dagegen habe ihr Vater erfolgreich geklagt. Auch der Spiegel habe später eine entsprechende Behauptung nach Einspruch ihres Vaters nicht weiterverfolgt. (Leider fragt Goldfinger sie nicht nach ihren frühen Erinnerungen. Wenn ihr Vater während des Krieges in Japan gewesen wäre, hätte er ja zu irgendeinem Zeitpunkt zurückkommen müssen, und diese Heimkehr hätte sich ihrem Gedächtnis als besonderes Ereignis eingeprägt.)
Im Verlauf des Besuchs kommt Edda Mildenstein auch auf Gerda Tuchlers Mutter (Arnons Urgroßmutter) zu sprechen. Sie hatte ihre Tochter1937 in Palästina besucht, war aber trotz der Bitten zu bleiben, nach Berlin zurückgekehrt. 1942 wurde sie nach Riga deportiert und ist dort umgekommen. Über das Schicksal ihrer Mutter hat Gerda Tuchler nie geredet, nicht einmal mit ihrer eigenen Tochter.
Noch immer hat Goldfinger keine Belege über Mildensteins Verbleib während des Krieges. Daher unternimmt er in Begleitung seiner Mutter eine zweite Reise nach Deutschland. Im Bundesarchiv in Berlin findet er schließlich einen von Mildenstein eigenhändig verfassten Lebenslauf, in dem er festgehalten hat, dass er 1938 in das Propagandaministerium von Joseph Goebels wechselte und dort als Referent für den Nahen Osten zuständig war. Mit dieser Information und einer Kopie des Lebenslaufes sucht Goldfinger noch einmal Edda Mildenstein auf, und dieser zweite Besuch war für mich die erschütterndste Szene des gesamten Films. Sie erstarrt förmlich, sie kann es nicht glauben. In jahrelangem Nachdenken und unter vielen Zweifeln hatte sie sich eine Geschichte zurechtgelegt, mit der sie leben konnte: Ihr Vater war zwar in der SS gewesen, aber am Haulocaust hatte er sich nicht beteiligt, er war ja weit weg in Japan und hatte sogar jüdische Freunde. Und jetzt zeigt der Lebenslauf eine ganz andere Wahrheit.
(Im Dez. 2013)

Bei einem mehrtägigen Venedig-Besuch im Spätherbst (die Biennale lief noch) zufällig auf mehrere schöne Ausstellungen gestoßen.
Im Palazzo Grimani, der nur selten seine Pforten dem Publikum öffnet, beschäftigte sich eine kleine Ausstellung mit dem Tizian-Gemälde „La Bella“. Seit langem war strittig, wen Tizian auf dem Gemälde porträtiert haben könnte. Daher hatte ein Team von Kunsthistorikern andere Porträts von ihm zum Vergleich herangezogen: Eleonora Gonzaga, Fanciulla mit Federhut, Laura im blauen Kleid, zwei weitere Porträts und das Gesicht der Venus von Urbino. In ihrer Analyse kamen sie zu dem Schluss, bei „La Bella“ handele es sich nicht um ein konkretes Porträt, sondern um das Idealbild einer schönen Dame, das Tizian aus Elementen der anderen Porträts zusammengesetzt hatte. Bei einem Rundgang durch den Grimani stößt man auf einige manieristische Deckenausmalungen, aber auch auf viele Spuren des Verfalls, und von dem vermutlichen größten Schatz des Hauses, einem Fresko, das Giorgione zugeschrieben wird, ist kaum noch etwas zu erkennen.
Der Palazzo Grassi präsentierte im Rahmen der Biennale den Südtiroler Künstler Rudolf Stingel. In den beiden Obergeschossen waren Wände und Böden aller Räume mit einem orientalisch gemusterten rot-schwarzen Teppich belegt, und verstreut hingen an den Wänden einige kleine Schwarzweißbilder, die zum Teil extra für diese Ausstellung angefertigt worden waren. Zum ersten Mal hatte das Museum alle Räume einem einzigen Künstler gewidmet, die Ausstellungsfläche soll 5000 Quadratmeter betragen haben. Von den beeindruckenden Raumdurchblicken habe ich Aufnahmen gemacht, aber wegen der Urheberrechtsproblematik möchte ich darauf verzichten, sie hier zu zeigen.
Im Peggy Guggenheim Museum lief ebenfalls eine Sonderausstellung. Mit 100 Gemälden und Zeichnungen aus Privatsammlungen wurde die Pariser Avantgarde im Fin-de-siècle (den 1890er Jahren) präsentiert. Schwerpunkte waren Neoimpressionisten, Symbolisten und Künstler der Nabis: Neben Signac, Denis, Bonnard und Valloton auch unbekannte Namen und von den ausgestellten Gemälden hoher Qualität hatte ich vorher keines gesehen – auch nicht in Katalogen oder Monographien.
Wenn man vom Guggenheim zu Fuß zurückschlendert, kommt man an der Accadémia vorbei, die ebenfalls mit einer Sonderausstellung zum Besuch einlud. Gezeigt wurden Zeichnungen von Leonardo, darunter zum ersten Mal seit zehn Jahren die Proportionsstudie mit den Maßen von Vitruv. Schon mal im Gebäude wollte ich mir einen kurzen Besuch bei Giorgiones immer noch geheimnisvollem „Gewitter“ nicht entgehen lassen. Inzwischen war es draußen dunkel geworden, und die meisten Besucher waren schon gegangen. Der Saal, in dem das Gewitter als Solitär an einer Querwand hängt, ohne von anderen Bildern bedrängt zu werden, war menschenleer, und ich konnte mich in Ruhe in dieses schöne Gemälde vertiefen. Von den vielen Interpretationen, die das Bild erfahren hat, halte ich Salvatore Settis‘ Ansicht, es handle sich um Eva und Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies, für am schlüssigsten.
An einem anderen Tag stieß ich in einem Raum des Stadtmuseums (M. Correr) auf einen künstlichen raumfüllenden Baum, in dessen weiß gespritztem Geäst hundert oder mehr Handys hingen. Sie waren alle eingeschaltet, aber tonlos und zeigten sprechende Menschen in Endlosschleifen.
(Nov. 2013)

Als ich vor zehn Jahren das Nachwort zu „Sigfrieds Tochter“ schrieb, habe ich die historischen Quellen und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fassungen des Stoffes nur gestreift, weil mein Augenmerk den zahlreichen literarischen Bezügen galt, die in den Roman eingeflossen waren und die ich festhalten wollte.
Historisch verarbeiten sowohl das Nibelungenlied als auch die Fragmente aus der Edda (bzw. die Völsungensaga) Ereignisse aus dem fünften und sechsten Jahrhundert mit dem Ende des Weströmischen Reiches, der Besetzung Oberitaliens durch die Ostgoten und den ersten hundert Jahren der fränkisch-merowingischen Königreiche. Sechs Hauptpersonen des Nibelungenliedes sind historisch nachgewiesen: Etzel, Bledel, Kriemhild, Gunther, Brünhild und Dietrich von Bern.
Attila (Etzel ist die süddeutsche Form des Namens) war von 434-453 König der Hunnen, und Bledel, eigentlich Bleda, war sein Bruder, der von ihm vermutlich im Jahr 434 ermordet wurde. Über Attila, sein Aussehen, sein Verhalten und seinen Hof in Ungarn existiert eine detaillierte Beschreibung eines Gesandten des Oströmischen Kaiserhofs in Konstantinopel. Auch über seinen Tod gibt es einen glaubwürdigen Bericht. Für das Jahr 453 ist die Hochzeit Attilas mit einer Prinzessin mit Namen Ildico historisch belegt. Noch in der Hochzeitsnacht starb Attila an einem Blutsturz. Als seine Getreuen am nächsten Morgen das Gemach aufbrachen, fanden sie eine zitternde und weinende Braut neben dem Bett, auf dem der tote König lag. Ob Ildico den Tag überlebt hat, ist nicht bekannt. Vermutlich nicht. Der Geschichtsschreiber Jordanes hat die Beerdigung detailliert beschrieben und berichtet, dass alle, die an der Beerdigung teilgenommen hatten, anschließend getötet wurden, damit sie die Lage des Grabes nicht verraten konnten.
Da der Name Ildico eine burgundische Verkleinerung von Hilde war, nimmt man an, dass sie eine burgundische Prinzessin war und dass im Lauf der Zeit aus Hildchen Hilde und aus Hilde Kriemhild wurde.
Hinter Gunther verbirgt sich der burgundische König Gundahari. Die Burgunden saßen ursprünglich wohl auf Bornholm (Burgundenholm), siedelten im dritten Jahrhundert am südlichen Ufer der Ostsee (westlich oder östlich der Oder) und zogen im vierten Jahrhundert ins Rhein-Main-Gebiet. Ob Worms zu ihrem Reich gehörte, ist historisch nicht belegt. Historisch ist dagegen ihre Niederlage gegen ein Heer der Hunnen im Jahr 437. In dieser Schlacht verlor Gundahari sein Leben. Danach trennte sich der Stamm, der größere Teil zog rheinaufwärts und dann in die Gegend von Besancon/Dijon, wo sie ein neues Königreich gründeten, das bis zum Genfer See reichte. Im sechsten Jahrhundert wurden sie von den Franken besiegt und Bestandteil des fränkisch-merowingischen Reiches. Geschichtliche Bedeutung sollten sie erst wieder im Spätmittelalter erreichen (unter Philipp III. und Karl dem Kühnen).
Brünhild oder Brunhild, eigentlich Brunichildis (Brunehaut im Französischen seit dem 13. Jahrhundert) war eine westgotische Prinzessin. Geboren um oder vor 550, heiratete sie 566 den merowingischen König Sigibert, dessen Halbbruder Chilperich ihre Schwester Gailswintha ehelichte, sich aber von seiner Konkubine Fredegunde nicht trennte. Als Gailswintha drohte, ihn zu verlassen, wurde sie auf Veranlassung Fredegundes und mit Billigung Chilperichs umgebracht. Daraus entstand ein jahrzehntelanger blutiger Familienkrieg, in dessen Verlauf Sigibert ermordet und an dessen Ende Brunichildis 613 grausam hingerichtet wurde. Chilperichs Sohn Chlothar ließ sie von einem Pferd zu Tode schleifen. Über die Vorgänge sind wir vergleichsweise gut unterrichtet, weil sie von Gregor von Tours in seinen „Zehn Bänden fränkischer Geschichten“ und von anderen Zeitgenossen überliefert worden sind. In Frankreich blieb Brunehaut im Volksgedächtnis länger lebendig als in Deutschland. Im 12. Jahrhundert erhielt sie ein Grab in der romanischen Kathedrale von Autun, und zahlreiche Landstraßen wurden nach ihr benannt. (Diese überraschende Information fand ich unter dem Titel „L’etrange histoire de la chaussee Brunehaut“ auf der Internetseite nordmag.com/ mit der Unterseite patrimoine/histoire_regionale/voies_com/histoire_brunehaut.htm)
In Deutschland dagegen fand ihr Sterben Eingang in Grimms Märchen. All die Hinrichtungen einer bösen Schwiegermutter dürften auf die grausamen Auseinandersetzungen im Merowingischen Königshaus zurückzuführen sein.
Zweifellos ist der Streit zwischen Brünhild und Kriemhild als Nachhall dieser Ereignisse ins Nibelungenlied eingegangen, und vielleicht ist auch der Name Sigfrid eine ferne Erinnerung an Sigibert, der von zwei gedungenen Attentätern mit vergifteten Dolchen getötet wurde.
Hinter Dietrich von Bern verbirgt sich der Ostgotenkönig Theoderich der Große, der von 456 bis 526 lebte. Nach dem Zug der Ostgoten nach Italien residierte er zunächst in Verona, bevor er 492 Ravenna eroberte und Odoaker umbrachte. Man nimmt an, dass der Dichter des Nibelungenliedes Bern mit Verona verwechselt hat.
Das Nibelungenlied und die Völsungensaga verarbeiteten nicht nur die erwähnten historischen Ereignisse aus dem fünften und sechsten Jahrhundert, sondern auch eine wahrscheinlich viel ältere mythologische Überlieferung des Drachentöters. Die Verschmelzung dieser voneinander unabhängigen Erzählstränge kann man als die besondere Leistung der Verfasser ansehen.
Das Nibelungenlied, wir es heute kennen, wurde in der Zeit um Zwölfhundert in der Gegend von Passau geschrieben. An mehreren Textstellen ist klar erkennbar, dass der Verfasser nie in Worms und am Rhein gewesen sein kann. Inzwischen wird auch die Ansicht vertreten, dass das Lied oder zumindest Teile davon (die sogenannten Schneider-Strophen) von einer Frau verfasst wurden, weil darin Details von Kriemhilds Hochzeitsvorbereitungen beschrieben wurden, die eigentlich nur Frauen wissen konnten. Dieser Auffassung ist Hanswilhelm Haefs, den ich in der Skizze „Lemprieres Wörterbuch“ vom Mai 2010 erwähnt habe.
Das Nibelungenlied beruht zweifelsfrei auf früheren Fassungen, von denen heute nur noch die auf Island im 13. Jahrhundert niedergeschriebenen Fragmente der Edda und die Völsungensaga erhalten sind. Vermutlich brachten Kaufleute der Hanse den Stoff nach Norwegen, und von dort gelangte er nach Island. Möglicherweise kam er aber auch schon früher über England nach Norwegen. Dafür spricht zum Beispiel die Erwähnung des Drachentöters an einer Stelle des im achten Jahrhundert entstandenen Beowulf. Diesen Hinweis fand ich in dem Buch „The Legend of Sigurd and Gudrun“ von Christopher Tolkien, das ich schon einmal in der Skizze „Tolkien und sein Ring“ im Juni 2011 erwähnt habe.
Die beiden Fassungen unterscheiden sich inhaltlich und hinsichtlich der Namen erheblich: Im Nibelungenlied wurde aus Sigurd Sifrit (Siegfried), aus Gunnar Gunther, aus seiner Schwester Gudrun Kriemhild, aus der alten Königin Chriemhild wurde Ute und aus Högni, einem Bruder Gunnars, der Gefolgsmann Hagen. Inhaltlich wurden alle Erinnerungen an die alten Götter der germanischen Mythologie getilgt oder bis zur Unverständlichkeit übermalt. Daher fehlt die gesamte Vorgeschichte: die Entstehung des Horts, warum Fafnir sich in einen Drachen verwandelte, wie Sigurd den Drachen erschlug und den Schatz gewann, wie er Brünhild aus ihrer Gefangenschaft befreite und wie sie sich einander versprachen. Im Nibelungenlied wird dagegen nur beiläufig erzählt, Siegfried habe den Schatz den Nibelungen - den im nördlichen Nebelland Lebenden - abgenommen. In der Völsungensaga reicht Gudruns Mutter Sigurd einen Zaubertrank, damit er Brünhild vergisst und sich in ihre Tochter verliebt. Dass Siegfried Brünhild schon vor der Brautfahrt nach Island kannte, dass sie sich versprochen hatten und dass Brünhild Siegfried erwartete, wird im Nibelungenlied nur angedeutet. Für Siegfrieds Erinnerungslücke gibt es keine Erklärung, und damit fehlt das eigentliche Motiv für Brünhilds Hass und Rache. Nach der Ermordung Sigurds wählt Brünhild den Freitod, im Nibelungenlied dagegen bleibt sie nach dem Untergang der Burgunden als Witwe in Worms zurück. Vermutlich wagte es der christliche Verfasser des Liedes nicht, die heidnische Geschichte der unsterblichen Walküre Brünhild, die von ihrem Vater Odin mit ewigem Schlaf hinter einer Waberlohe bestraft worden war, zu erzählen. Entsprechend hat er auch Brünhilds Freitod nicht übernommen.
Teile des Stoffs finden sich auch in anderen Sagenkreisen. Siegfried wird in der Thidrekssaga erwähnt, Gunther und Hagen im viel älteren Waltharilied (das vermutlich im 6. oder 7. Jahrhundert entstanden ist). Dem Verfasser des Nibelungenliedes war das Waltharilied bekannt, denn er erwähnt Ereignisse daraus ausdrücklich am Ende der Saalschlacht. Weiterhin erzählt der spätmittelalterliche „Hörnene Siegfried“ die Jugend Siegfrieds und seine Begegnung mit der burgundischen Königstochter, die hier zur Abwechslung Florigunde heißt, in anderer Form. Schließlich wäre noch die Klage zu erwähnen, der dritte Teil des Nibelungenliedes, in dem die Schicksale der Überlebenden geschildert werden.
Nach der Auffindung der Nibelungenhandschrift im 18. Jahrhundert haben sich die literarischen Bearbeitungen des Stoffes entweder an die eine oder an die andere Version gehalten. Die erste literarisch bedeutende Fassung war die Trilogie „Der Held des Nordens“ von Friedrich de la Motte Fouqué, die der Völsungensaga folgte. Hebbel dagegen hat für sein Drama das Nibelungenlied verwendet, leider den mythologischen Hintergrund weitgehend ausgeblendet und Brünhild ab der Hälfte seines Dramas schlicht „vergessen“. Wagner hingegen benutzte für den Ring de la Motte Fouqué. Man kann Wagner bezüglich des Versbaus und des Sprachrhythmus sogar als Fouqués Schüler betrachten.
Abschließend möchte ich noch einmal auf das Buch „The Legend of Sigurd and Gudrun“ von Christopher Tolkien hinweisen. Als Einstieg in die komplexen Zusammenhänge ist es gut geeignet.
(Im Okt. 2013)
Bei der jährlichen Erinnerung an die Zerstörung der Synagogen im Nov. 1938 wird seit den 80er Jahren in den Medien fast ausschließlich der Begriff Pogrom anstelle des älteren Wortes Reichskristallnacht verwendet. Auch Raphael Gross, Prof. am Leo Baeck Institute in London, behandelt in seinem Buch November 1938 die Begriffe Reichskristallnacht, Pogromnacht usw., greift die in den 80er Jahren aufgekommene Kritik am Wort Reichskristallnacht auf und empfiehlt die Verwendung des Wortes Novemberpogrome.
Meinem Sprachgefühl nach ist die Verwendung des russischen Wortes Pogrom zeitgeschichtlich und sprachlich nicht nur nicht angemessen, sondern auch irreführend. Die kritisierte „Reichskristallnacht“ ist kein Begriff, der von den Nationalsozialisten geprägt wurde. Die sprachen euphemistisch nur von der „Novemberaktion“ oder (nach Eugen Kogon) von der „Rath-Aktion“. Dazu als Beleg ein Zitat aus dem 1946 erschienenen „SS-Staat“ von Kogon: „Im November 1938 führte das Revolverattentat, das der Jude Grünspan in Paris auf den dortigen deutschen Gesandtschaftssekretär v. Rath verübt hatte, in ganz Deutschland zur sogenannten Rath-Aktion gegen die Juden …“ (S. 209 meiner Ausgabe aus der fünften Auflage mit einem Vorwort aus dem Jahr 1959).
Wo und wann der Begriff „Kristallnacht“ entstanden ist, weiß ich nicht. In einem Wikipedia-Artikel über die „Novemberpogrome 1938“ wird Adolf Arndt zitiert, der 1965 vor dem Bundestag erklärt hatte, der Begriff Kristallnacht sei als blutiger Berliner Witz entstanden. Weiter wird in dem Wikipedia-Artikel gesagt, der Ausdruck habe schon lange seine bitter-ironische Distanz gegenüber dem Staatsterror verloren und deshalb habe sich schon in den 1950er Jahren die Meinung durchgesetzt, damit könnten die Ereignisse vom November 1938 nicht historisch dauerhaft bezeichnet werden.
Als Zeitzeuge der 50er und 60er Jahre kann ich diese Ansicht nicht teilen. In jenen Jahren wurde dieser Begriff in Gesprächen, im Geschichtsunterricht, in Rundfunksendungen und in Publikationen durchgängig verwendet. Als Beispiele seien die „Propyläen Weltgeschichte“ von Golo Mann (1960) und „Aufstieg und Fall des Dritten Reiches“ von William Shirer (1960) angeführt. Noch 1978 kennt Wahrigs „Wörterbuch der deutschen Sprache“ das Wort Pogrom nicht.
Alle Zeitzeugen der Novemberverbrechen, die ich kannte (meine Großmutter, meine Eltern, Nachbarfamilien, meine Lehrer der 50er Jahre, später meine Schwiegereltern), sprachen stets nur von der Reichskristallnacht. Das russische Wort Pogrom war unbekannt und wurde in diesem Zusammenhang nie benutzt.
Als Beleg möchte ich auch meine eigenen Erinnerungen anführen: Ich ging noch zur Volksschule und war acht, vielleicht auch neun Jahre alt, als mir meine Großmutter bei mehreren Spaziergängen durch unsere Stadt (eine süddeutsche Kleinstadt) einen leeren Platz zeigte und erklärte, hier habe die jüdische Synagoge gestanden, die hätten die Nazis 1938 zerstört und in Brand gesetzt. Meiner Erinnerung nach hörte ich da von ihr zum ersten Mal das Wort „Kristallnacht“. Da sie gute Gründe hatte, die Nationalsozialisten zu hassen (ihr Mann, mein Großvater, war nach der Machtübernahme 1933 im Rahmen des berüchtigten Gesetzes zur Wiedereinführung des Berufsbeamtentums aus dem Staatsdienst entlassen worden), besaß sie keinen Anlass, die entsetzlichen Ereignisse sprachlich zu verharmlosen.
Der abstruse Begriff Reichspogromnacht, der jetzt immer öfter auftaucht, scheint erst Ende der 80er oder in den 90er Jahren entstanden zu sein. Es ist mir vollkommen unverständlich, warum dieses aus dem Russischen entlehnte Wort so schnell Karriere machen konnte; inhaltlich ist die Reichspogromnacht ein abstraktes Unding, sprachlich ein Zungenbrecher und zeitgeschichtlich falsch.
Es gibt überhaupt keinen Grund, nach einem neuen Wort zu suchen, um die Kristallnacht zu er-setzen. Das Wort ist ausdrucksstark und ein bildmächtiger Begriff. Es ist durchaus keine böswillig-verharmlosende Bezeichnung. Man kann sich sofort vorstellen, was damit gemeint ist: Kristall wird zerbrochen, Glas wird zerschlagen und fällt zu Boden, zersplittert – wie der Spiegel in Andersens Schneekönigin – in tausend Scherben, die die Erde bedecken und die Wut und den Hass der sinnlose Zerstörung bezeugen.
Bei Verwendung des russischen Fremdwortes besteht eher die Gefahr einer Verharmlosung. Denn man könnte auch beschönigend argumentieren: Dass wir ein bestehendes Wort aus einer anderen Sprache übernommen haben, zeige doch, dass es anderswo bereits vorher entsprechende oder noch schlimmere Judenverfolgungen gegeben habe. Und eine derartige Argumentationskette kann bestimmt nicht in unseren Absichten liegen …
(Im Sept. 2013)
Bei Scala ist 2011 eine umfangreiche Zusammenstellung der Kunst des Manierismus erschienen. Detailliert zeigt der Band die Entwicklung in Rom, Florenz und Norditalien und ergänzt die Gemäldeabbildungen mit vorzüglichen Fotos von Innenräumen. Was das restliche Europa betrifft, zeigt der Band jedoch Lücken. So fehlen von Maarten van Heemskerck wichtige Gemälde, die Dossi-Brüder sind nicht vertreten, obwohl „Die Nacht“ von Battista Dossi ein Schlüsselbild des Manierismus ist, und auch François de Nomé wird nicht einmal namentlich erwähnt.
Dabei hat Gustav René Hocke in seinem 1957 veröffentlichten bahnbrechenden Buch über den Manierismus „Die Welt als Labyrinth“ den Namen Desiderio Monsù schon in der Einleitung genannt und dem dahinter verborgenen unbekannten Maler einen längeren Abschnitt als „vielleicht bedeutendste Entdeckung der letzten Jahre und rätselhaftester Maler Europas zwischen 1600 und 1650“ gewidmet. Aufgetaucht war der Name Desiderio Monsù zum ersten Mal in einem Bestandsverzeichnis einer adeligen Privatsammlung im 18. Jahrhundert. Hocke beschrieb den Maler als Schöpfer phantastischer Architekturen, halluzinatorischer Traumkastrophen und Vorläufer der Surrealisten zur Zeit Shakespeares. (Der schwarzweiße Abbildungsteil des Buches enthielt auch acht Gemälde von Desiderio Monsù, aber keine Quellenangaben. 1987 publizierte der Rowohlt-Verlag eine großformatige Neuausgabe, veränderte dabei aber ziemlich willkürlichen den Abbildungsteil, der ursprünglich 254 Bilder enthalten hatte, reduzierte Desiderio Monsù auf vier Gemälde und ließ ausgerechnet das Bild, das Hocke näher beschrieben und mit dem Notnamen „Apoll und der Kleeblattmond“ betitelt hatte, ganz weg. Außerdem fehlten auch in dieser Ausgabe sämtliche Quellenangaben, und ich konnte bis heute keine farbige Abbildung des Gemäldes ausfindig machen.) Bei der selbstgestellten Frage, wer die Bilder gemalt haben könnte, brachte Hocke zwei Namen ins Spiel: François de Nomé und Didier Barra. Beide stammten aus Metz, und beide hatten nach 1610 in Neapel gelebt. Monsù wurde als neapolitanische Verballhornung von Monsieur und Desiderio von Didier gedeutet.
Nach weiteren Nachforschungen wurde die These aufgestellt, Nomé und Barra hätten ein gemeinsames Atelier betrieben und auch die Nacht- und Traumbilder gemeinsam gemalt. Obwohl keinerlei Dokumente dazu vorliegen, hielt sich die These bis in die jüngste Zeit. Noch auf der großen Retrospektive in Metz im Jahr 2005 wurde sie vertreten, obgleich eindeutig Nomé oder Barra zurechenbare Gemälde deutliche stilistische Unterschiede zeigen; Batrra hat viele Hafenbilder mit dunklem Gewitterhimmel gemalt, aber keine leeren nächtlichen Städte oder zusammenstürzenden Kirchenräume. Heute ist man daher der Ansicht, François de Nomé sei der alleinige Maler der zwischen 1615 und 1630 entstandenen nächtlichen Szenen und Traumbilder. Auch die These, er habe an Schizophrenie gelitten, weil er bestimmte Motive ständig wiederholt habe, wird inzwischen zurückgewiesen. Nur ein Bild, „Die Hölle“, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Zusammenarbeit mit einem anderen Maler entstanden und zwar mit Jacob van Swanenburgh (bekannt durch „Der Nachen des Charon“).
Dass François de Nomé immer noch weitgehend unbekannt ist, liegt vielleicht daran, dass seine Bilder entweder in Privatsammlungen oder in kleineren Museen hängen. In den großen westeuropäischen Museen ist er so gut wie nicht vertreten. Glücklicherweise hängt „Die Hölle“ in einem öffentlichen Museum in Becançon.
Über Monsù Desiderio ist 1981 bei Laffont eine schön gestaltete Monographie erschienen. Außerdem ist der Katalog der Ausstellung in Metz sehr empfehlenswert.
(Im Aug. 2013)

Im Herbst 1960, ein Jahr vor dem Mauerbau, reiste ich zum ersten Mal nach Berlin, besuchte die Gedenkstätte Plötzensee, aber auch das Pergamonmuseum auf der Museumsinsel und das Museum in Dahlem. Es war keine Klassenfahrt meines Gymnasiums, sondern eine von der Volkshochschule veranstaltete politische Bildungsreise. Vor Reisebeginn wurden die Teilnehmer zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und erhielten Verhaltensregeln für die Grenzkontrollen und Aufenthalte in Ost-Berlin. Unter anderem wurden wir instruiert, uns auf keine Diskussionen mit Funktionären von der FDJ einzulassen, die seien viel besser geschult und uns argumentativ haushoch überlegen. Was stimmte: Wir hätten weder über den Dialektischen Materialismus und eine Zielgerichtetheit der Geschichte noch über staatliche gelenkte Wirtschaftspolitik und den Kapitalismus diskutieren können.
Von dem Museumsbesuch in Dahlem habe ich nur die Büste der Nofretete im Gedächtnis behalten. Sie stand schon damals unter einem Glassturz auf einem Sockel, aber in einem nicht sehr großen Raum und war nur ein Ausstellungsstück unter vielen anderen. Ich kannte ihr Bild bereits aus Zeitschriften, sie wurde für irgendeine Reklame benutzt. Im Pergamonmuseum waren wir natürlich alle vom Ischtartor überwältigt, aber deutlicher habe ich ein Gespräch mit einem Aufseher in den Räumen mit islamischer Kunst in Erinnerung. In ausgelegten Handschriften hatte ich einige Abbildungen von Menschen entdeckt und war darüber sehr verwundert, weil wir doch in der Schule gelernt hatten, Abbildungen von Menschen seien in der islamischen Kunst untersagt. Das stimme so nicht, erklärte mir der Aufseher, ein älterer Mann, verboten seien nur die Abbildung Allahs und seines Propheten Mohammed. Außerdem habe man das Bilderverbot in den einzelnen Epochen unterschiedlich gehandhabt.
Bis zu meinem nächsten Besuch auf der Museumsinsel sollten 30 Jahre vergehen, erst im Sommer1991 sah ich das Ischtartor wieder und besuchte zum ersten Mal auch die anderen zugänglichen Museen auf der Insel, wobei mir vor allem das Bode-Museum trist und verwahrlost vorkam. In den folgenden Jahren kam ich öfter zu Wechselausstellungen nach Berlin und auf die Museumsinsel, z. B. 2005 zur Goya-Ausstellung in der Alten Nationalgalerie, 2006 zur Melancholie-Ausstellung in der neuen Nationalgalerie und 2008 zur Babylon-Ausstellung. In der Babylon-Ausstellung stieß ich auf eine faszinierende, mir bislang unbekannte Darstellung der Göttin Ischtar (oder Istar). Sie war die babylonische Göttin der Nacht und des Krieges, der Fruchtbarkeit und laut Herodot der Prostitution. Man sieht sie als nackte Frau mit großen Flügeln und mit Klauen anstelle der Füße, die sich in den Rücken eines Löwen krallen. Links und rechts des Löwen stehen noch zwei Eulen. Im Althebräischen wurde aus Ischtar Aschtarot, die Griechen haben daraus Astarte und Astron gemacht, woraus bei den Römern Stella entstand. Auch der Vorname Esther sowie Star und Stern stammen von Ischtar ab. Vielleicht sind auch die Eulen der Göttin Athena eine ferne Reminiszenz an die babylonische Göttin.
Nofretete habe ich erst nach der Neueröffnung des Neuen Museums wiedergesehen, also ein halbes Jahrhundert nach unserer ersten Begegnung und jetzt erneut in der Ausstellung „Im Licht von Armana“, die dem hundertjährigen Jubiläum ihrer Auffindung gewidmet ist. Im Neuen Museum hat sie einen sehr schönen Platz mit freiem Blick durch die Raumflucht bis zum römischen Sonnengott am andern Ende des Gebäudes.
Nofretete gehört zu den Altertümern, die die Heimatländer als Eigentum beanspruchen und zurückführen wollen. Angesichts der Plünderungen während des arabischen Frühlings und angesichts der Kulturzerstörungen im Irak durch den IS sollte man dankbar sein, dass Kunstwerke des Altertums aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten in europäischen Museen vergleichsweise gut geschützt sind. Sie sollten dort auch bleiben, weil sie zu den Wurzeln unserer Zivilisation gehören. Die barbarischen Aktionen des IS im Irak sollen wohl erreichen, dass das Band der Bevölkerung zur großen historischen, vorislamischen Vergangenheit zerschnitten wird. Gleichzeitig sind diese Aktionen Angriffe auf das Zivilisationsverständnis der westlichen Welt. Leider handelt es sich jedoch nicht um ein besonderes Merkmal der gegenwärtigen islamischen Radikalisierung, sondern um ein Verhalten, das überall anzutreffen war. Denken wir nur an die Bücher- und Gemäldeverbrennungen des Nationalsozialismus, die Zerstörungen in Mexiko durch die Spanier und der heidnischen germanischen und römischen Heiligtümer im Verlauf der Christianisierung. Leider lernen wir nichts aus den Fehlern unserer Geschichte.
(Mai 2013 – mit Ergänzungen vom Febr. 2015)
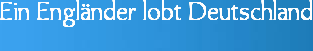
Beim Warten auf den Zug entdeckte ich in einer Berliner Bahnhofsbuchhandlung einen dicken Buchrücken mit dem Titel: The German Genius. Da eine lange Bahnfahrt bevorstand, nahm ich das Buch kurzentschlossen mit, ohne zu ahnen, dass es mich die folgenden drei Monate nicht mehr loslassen würde. Es wurde von dem englischen Journalisten Peter Watson verfasst und enthält auf knapp 1000 Seiten eine Beschreibung der deutschen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte der letzten 250 Jahre. In 42 chronologisch und thematisch eingeteilten Kapiteln schreibt der Autor über die Entwicklung der deutschen Literatur, Musik, bildenden Kunst, Philosophie, über Entdeckungen und Erfindungen, die Universitätsreform vor 200 Jahren in Göttingen und Berlin, den Aufstieg der Mittelklasse im 19. Jahrhundert und den Zeitgeist der einzelnen Epochen (z. B. über Wien vor dem Ersten Weltkrieg).
Dabei zeigt der Autor erstaunliche Kenntnisse, die man gerade von einem Engländer nicht erwartet hätte. Er lobt den „Nachsommer“ von Stifter und weiß, dass Keller zwei Fassungen des „Grünen Heinrichs“ geschrieben hat. Man stößt auf Sätze wie: "Die italienische Renaissance ist eine deutsche Erfindung." Oder: "Bis 1930 hatte Deutschland mehr Nobelpreise als die USA und England zusammen." Er ist ein Meister knapper Charakterisierungen. Über Kafka z. B. schreibt er: "A slim, well-dressed man with a hint of a dandy about him, he had trained in law and worked successfully in insurance." Mit verblüffender Schärfe beschreibt er den Einfluss, den die deutschen Emigranten auf das amerikanische Denken hatten (Kap. 39: The Effect of German Thought on America). Durchweg ist das Buch auf einem hohen Niveau verfasst. Lediglich die beiden letzten Kapitel über die Entwicklung nach 1945 fallen etwas ab. Hier fehlt noch der Abstand für eine angemessene Bewertung.
Es ist vielleicht das Besondere an dem Buch, dass es von einem englischen Autor mit freundlicher Distanz ohne Vorurteile (kein "German Bashing") geschrieben wurde. Besonders interessant ist auch, wie er versucht, seinen Lesern deutsche Begriffe wie z. B. "Bildung" umschreibend zu erklären.
(April 2013)

Als in Berlin diskutiert wurde, die Gemäldegalerie Alter Meister am Kulturforum für Sammlungen der Moderne zu nutzen und die Alten Meister für Jahre ins Depot zu sperren, startete die FAZ eine Reihe mit Bildbesprechungen von Gemälden, die dann lange nicht mehr zu sehen gewesen wären. Zu den besprochenen Gemälden gehörte auch „Cephalus und Procris, von Diana versöhnt“ von Claude Lorrain.
Die Geschichte von Cephalus/Kephalos und Procris/Prokris muss im 16. Und 17. Jahrhundert ziemlich bekannt gewesen sein. Zumindest wurde sie häufig gemalt, der Tod der Prokris z. B. schon von Piero di Cosimo, von dem niederländischen Manieristen Joachim Wtewael und später auch von Fragonard. Auch Claude hat mehrere Fassungen gefertigt, eine weitere Version hängt in der National Gallery in London, eine andere in einer römischen Privatsammlung.
Da aber heute vermutlich niemand mehr mit dieser Geschichte aus der griechischen Mythologie vertraut ist, die darüber hinaus in mehreren unterschiedlichen Varianten überliefert wurde, hier zunächst eine Zusammenfassung: Nach Ehebruch und einem weiteren Täuschungsversuch ihres Gatten flüchtet Prokris in die Wälder und schließt sich den Nymphen der Göttin Diana (bzw. der Artemis) an. Die Göttin schenkt ihr einen unfehlbaren Jagdspeer und leitet die Aussöhnung des zerstrittenen Paares ein. Bei dieser Aussöhnung übergibt Prokris ihrem Gatten den Jagdspeer als Zeichen der Vergebung.
Als jedoch Kephalos zur Jagd aufbricht, erwacht bei Prokris wieder Eifersucht, sie folgt ihm in den Wald und verbirgt sich im Gebüsch. Dort wird sie von ihm mit dem unfehlbaren Speer der Göttin getötet, weil er sie für Jagdwild gehalten hat. (Andere Versionen, zum Teil mit wechselseitigem Ehebruch, kann man bei Kerényi nachlesen.)
Auf dem Berliner Gemälde sieht man drei Personen und einen Hund (der auch ein Geschenk war) vor dunklen Bäumen und einer Gebirgslandschaft im Hintergrund. Links steht Kephalos, rechts seine Gattin Prokris, zwischen beiden die Göttin Diana (Artemis) mit ausgestreckten Armen, den Kopf Prokris zugeneigt. Der Himmel ist gelb verfärbt, die Sonne steht tief hinter den Bäumen, es ist die Zeit der Dämmerung.
Die Bildinterpretation des Berliner Gemäldes stammt von Charlotte Klonk, Professorin für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie beginnt ihren Text mit dem interessanten Satz, was man sieht, könne die Schlusseinstellung eines schlechten Films sein. Nach vielen dramatischen Verwicklungen sei endlich alles gut, die Liebenden hätten wieder zueinander gefunden. Ausdrücklich verweist sie dabei auf die Tageszeit: Passend zum Happy End tauche der Sonnenuntergang die Welt in ein goldenes Licht. Nach weiterer ausführlicher Beschreibung der Versöhnungsszene erzählt sie die Geschichte jedoch nicht zu Ende, sondert spricht über die Nachwirkungen, das Echo, das Claude mit seinem Malstil in der englischen Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts hervorgerufen hat. Erst nach einer langen Abschweifung kommt sie auf das Bild zurück und schreibt, bei genauem Hinsehen ahne man die bald hereinbrechende Nacht und erkenne in den abgestorbenen Bäumen im Vordergrund, dass es auch bei Claude Lorrain kein Happy End gäbe.
Nun hat aber Claude über seine verkauften Gemälde Buch geführt, das Liber Veritatis und darin im Jahr 1665 eine "Morgenlandschaft mit Diana, Cephalus und Procris" festgehalten. Wenn es sich bei dem Berliner Bild um dieses Gemälde handelt, dann fällt die schöne, romantisch beschriebene Geschichte der Aussöhnung im goldenen Licht der Abendsonne und von den dunklen Gefahren der einbrechenden Nacht wie ein Kartenhaus zusammen.
(Im Febr. 2013)
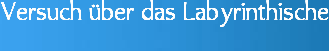
Vermutlich angeregt von der Geschichte des Minotaurus oder auch der Abbildung eines in den Steinboden einer Kathedrale eingelassenen Labyrinths habe ich während meiner Schulzeit im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren eine Zeitlang (meistens, wenn ich keine Lust hatte, Hausaufgaben zu machen) Labyrinthe entworfen. Sie nahmen immer eine ganze Seite eines Zeichenblocks ein und besaßen an den Rändern mehrere Eingänge, von denen aber nur einer den Weg zum Ziel in der Mitte des Labyrinths öffnete. Ich zeichnete schmale Gänge mit unterschiedlich breiten Verzweigungen, wobei die breiten Öffnungen immer in einer Sackgasse endeten, während der richtige Weg in entgegengesetzte Richtung verlief. Ich testete die Schwierigkeit, indem ich die Labyrinthe Mitschülern zeigte, die – nach meiner Erinnerung – fast nie den Weg fanden, sondern sich verirrten und aufgaben. Dadurch ermutigt zeigte ich eines Tages unserem Kunstlehrer eins meiner Labyrinthe, und zu meiner großen Genugtuung verirrte er sich auch auf dem Weg vom gewählten Eingang zum Ziel. Dann jedoch setzte er seinen Bleistift im Zielfeld an und verfolgte den Weg zum Eingang zurück, wofür er nur wenig Zeit brauchte. Ich war empört. Das war doch Pfusch! Aber ich habe daraus viel gelernt, nämlich, dass man, wenn man vor einem schwierigen Problem steht, es von unterschiedlichen Seiten betrachten sollte und dadurch vielleicht eher eine Lösung findet.
Über einen möglichen historischen Hintergrund des Labyrinths mit den Geschichten vom Minotaurus, von Theseus und Ariadne, von Dädalus und Ikarus habe ich mir damals dagegen keine Gedanken gemacht und bin erst Jahrzehnte später in einem Buch von Jan Pieper (einem Prof. für Architekturgeschichte) auf eine interessante Hypothese über das legendäre Bauwerk gestoßen. Zunächst einmal stellt der Autor fest, dass das Labyrinth auf Kreta das einzige Bauwerk war, das in der Mythologie des klassischen Altertums eine zentrale Rolle spielte, und dass die Bezeichnung „Labyrinth“ schon in der Antike für große und verwickelte Gebäude sprichwörtlich geworden war. Deshalb hatte man auch schon im Altertum in der Gegend von Knossos nach den Überresten des Baus gesucht. Da man aber schon damals keine Spuren mehr eines vermutlich sehr großen Gebäudes fand, meinten einige antike Geschichtsschreiber, das weitverzweigte Höhlensystem bei Gortyna (einer Stadt im Süden Kretas) müsse als Steinbruch oder als unmittelbares Vorbild für das von Dädalus erbaute Labyrinth gedient haben. Diese Ansicht wurde noch von Reisenden in der Neuzeit geteilt, bis Arthur Evans, der Ausgräber des Palastes von Knossos, glaubte, in dem verwickelten Raumsystem des Palastes das historische Labyrinth gefunden zu haben.
Pieper beginnt seine Schlussfolgerungen mit einer Betrachtung der Entstehungszeit des Mythenkreises um Theseus, die um 1400 v. Chr. anzusetzen ist. Damals war das minoische Kreta die beherrschende Seemacht mit einer im Vergleich zu den noch in bäuerlichen Gemeinschaften lebenden Griechen überlegenen städtischen Hochkultur. Den archaischen Griechen muss Knossos (nach Evans hatte die Stadt einhunderttausend Einwohner) ungeheuerlich erschienen sein. Die in den Theseusmythos eingebettete Labyrinthepisode (die übrigens Homer nicht kannte) wäre demnach nichts anderes die Rezeption der verwirrenden, verschachtelten, aus Stein erbauten volkreichen Stadt durch die nicht-städtische Welt der ungehobelten Barbaren aus dem Norden. Pieper unterstützt seine Interpretation mit der Etymologie des Wortes. Das ursprüngliche Sinnfeld sei „Steinbau, künstlich gewonnener Stein und gepflasterte Straße“ gewesen.
Die Geschichte von Theseus und dem Labyrinth des Minotaurus wurde im Lauf der Jahrhunderte nicht vergessen und sogar vom Christentum vereinnahmt. In Kirchen als Bodenlabyrinth zu sehen, sollte es den Menschen ermahnen, auf seinem Lebensweg nicht in die Irre zu gehen. Offenbar war der Begriff des Labyrinths schon im Hochmittelalter auch im übertragenen Sinn als Metapher gebräuchlich. So findet man bei Francesco Petrarca in seinem Gedicht über seine erste Begegnung mit seiner Geliebten Laura im Jahr 1327 den Satz, bei ihrem Anblick habe er ein Labyrinth betreten und finde keinen Ausweg.
In der bildenden Kunst wurde das Labyrinth seit dem 15. Jahrhundert häufig dargestellt – aber meist nur als Zeichnung oder Stahlstich, sehr selten auf einem Gemälde. In Stein nachgebaut wurde das Labyrinth nie, aber Gartenlabyrinthe wurden in der Renaissance und den folgenden Jahrhunderten sehr oft geschaffen. Jetzt hat der italienische Verleger Franco Maria Ricci angekündigt, in Fontanellato, einem kleinen Ort wenige Kilometer nordwestlich von Parma, ein Gartenlabyrinth mit übermannsgroßen Bambussträuchern anzulegen. Es soll nach der Fertigstellung im Jahr 2015 als größtes Labyrinth der Welt eröffnet werden. Über das Projekt hat er ein sehr schönes Buch unter dem Titel „Labyrinths. The Art oft the Maze“ herausgebracht.
Nach dem Debakel durch die Rückwärtslösung des Kunstlehrers habe ich keine Labyrinthe mehr gezeichnet, aber später ein Interesse für labyrinthische Literatur und Filme entwickelt. Das erste literarische Werk, das mir Anfang der 60er Jahre zum Thema Labyrinthe auffiel, war die gleichnamige Sammlung von Kurzgeschichten des argentinischen Autors Jorge Luis Borges, der damals in Deutschland noch weitgehend unbekannt war und zur ersten großen literarischen Entdeckung der lateinamerikanischen Literatur wurde – Jahre bevor alle Welt über Gabriel Garcia Márquez und den Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ redete.
Was mich an seinen Geschichten besonders faszinierte, war der Punkt, an dem der zunächst rationale Verlauf plötzlich kippt und die Handlung eine unberechenbare, unbegreifliche Wendung nimmt. Man könnte auch sagen: Wo der Boden, auf dem man steht, sich plötzlich als dünnes Eis herausstellt, das bricht … Beispielhaft sei hier die kurze Parabel der beiden Könige und der beiden Labyrinthe erwähnt: Ein König aus Arabien, der von dem König aus Babylon in ein gebautes Labyrinth geführt wird, sich dort verirrt und nur mit Mühe den Ausgang findet, rächt sich, indem er einen Krieg beginnt und den anderen König gefangennimmt. Dann führt er ihn in die Wüste und sagt, bevor er ihn dem Verdursten und Verhungern überlässt, hier sei sein Labyrinth – ohne Mauern, endlose Gänge, Treppen und Türen … Der schmale Band enthielt auch die heute berühmten Geschichten „Die Bibliothek von Babel“, „Das Aleph“ und die „Averroes auf der Suche“. Übrigens hat sich damals Dieter E. Zimmer in der ZEIT sehr für den Autor eingesetzt und auch einige Erzählungen ins Deutsche übertragen. Ein anderer Bewunderer war Umberto Eco, der Borges in seinem Roman „Der Name der Rose“ als Vorbild für den blinden Mönch Jorge von Burgos, den Bibliothekar der labyrinthischen Klosterbibliothek, benutzte. Borges litt nämlich an einer Sehschwäche und erblindete mit 50 Jahren, konnte aber seine Tätigkeit als Direktor der argentinischen Nationalbibliothek in Buenos Aires weiter ausüben.
Während Borges seine labyrinthischen Gedankengänge in die Form knapper Erzählungen brachte, hat einhundertfünfzig Jahre früher Jan Potocki mit der „Handschrift von Saragossa“ ein ausuferndes Werk verfasst, das man als Ahnherrn alter modernen labyrinthischen Romane betrachten kann. Jan Graf Potocki (1761 bis 1815) stammte aus einer polnischen Adelsfamilie, lebte vor der französischen Revolution einige Jahre in Paris und unternahm später für den russischen Zaren mehrere Forschungsreisen, wovon eine bis an die Grenzen Chinas führte.
Sein Roman „Die Handschrift von Saragossa“ besteht aus einer Unzahl einzelner, teilweise miteinander verknüpfter Geschichten, die immer wieder unterbrochen werden und nur durch eine Rahmenhandlung von sechsundsechzig Tagen Zusammenhalt finden. So kommt es vor, dass eine Geschichte, die am zwanzigsten Tag begonnen hatte, erst am dreiundvierzigsten Tag fortgesetzt wird. An dem Roman hat Potocki vermutlich zwölf Jahre gearbeitet – von 1803 bis zu seinem Selbstmord im Jahr 1815. Nach dem Bericht eines Zeitgenossen war die langwierige Krankheit seiner Frau der eigentliche Anlass seiner Entstehung. Um sie zu unterhalten, las er ihr abends eine Geschichte vor, die er tagsüber niedergeschrieben hatte.
So abenteuerlich und verwickelt wie der Roman war auch die Geschichte seiner Veröffentlichung. Zu Lebzeiten wurde von dem Text nur der Anfang (etwa ein Drittel) auf Französisch veröffentlicht, danach noch einige Teile, wobei die jeweiligen Herausgeber den Namen Potockis verschwiegen. Die erste Gesamtausgabe erschien erst 1956 auf Französisch und 1961 auf Deutsch. Danach wurden weitere Bruchstücke in Polen entdeckt und in den Text eingefügt, was dazu führte, dass beispielsweise auf Deutsch drei verschiedene Fassungen vorliegen.
Die Form des Romans (eine Geschichte in einer Geschichte einer weiteren Geschichte zu erzählen, abzubrechen und später fortzusetzen) wurde in den letzten Jahrzehnten wiederholt aufgegriffen, z. B. von Herbert Rosendorfer „Der Ruinenbaumeister“, von Miquel de Pagnol „Im Garten der sieben Dämmerungen“ und von David Mitchell „Cloud Atlas“. Mitchell erzählt nach dem Zwiebelschalen-Prinzip sieben Geschichten, beginnt die erste und bricht sie ab, beginnt die zweite und bricht sie ab usw. Die siebte Geschichte wird ohne Unterbrechung erzählt, danach wird die sechste wiederaufgenommen und zu Ende erzählt usw bis zur ersten. 2012 wurde der Roman mit Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant und u. a. Susan Sarandon verfilmt, die starre Gliederung des Buchs aber nicht übernommen. Vielmehr wurde jede Geschichte in jeweils drei oder vier Abschnitte geteilt, die in unregelmäßigen Abständen aufeinander folgten. Dadurch benötigt ein Filmbesucher mindestens eine Stunde, bis er die Zusammenhänge begriffen hat. Mir hat diese Verschachtelung gut gefallen, viele Zuschauer empfanden aber das Puzzle als zu anstrengend.
(Jan. 2013)

Die Neubewertung des Symbolismus in den 60er Jahren (vgl. dazu: Der Kuss der Sphinx … vom März 2008) führte auch dazu, dass die Präraffaeliten wiederentdeckt und ihre farbintensiven Bilder dem Publikum als durchaus beachtenswerte Kunst vorgestellt wurden. Noch 1962 war beispielsweise in der bekannten „Kunstgeschichte unserer Welt“ von Horst Janson nicht einmal der Begriff erwähnt worden, und noch 1975(!) leitete Karl Heinz Bohrer eine Besprechung einer Londoner Ausstellung der Werke von Edward Burne-Jones mit den Worten ein: „Vor fünf Jahren noch kam der Anblick präraffaelitischer Bilder einer Entdeckung gleich.“
Mich haben die ideologiekritischen Diskussionen über die Unangemessenheit des schönen Scheins angesichts einer hässlichen Gegenwart stets kaltgelassen, weil der Neid der Unfähigkeit oft zu deutlich durch den Dogmatismus linker Ästhetik schimmerte. (Hier sei eine Abschweifung erlaubt: Günter Grass hat mit seiner Blechtrommel eine Hommage an Danzig geschrieben – aber er hat in dem Roman mit keinem Wort die Schönheit der Stadt vor dem Krieg erwähnt, weil diese Schönheit eine Ergebnis der Bürgerkultur des 19. Jahrhunderts war, die ihm nicht passte.)
Nach meinen ersten Begegnungen mit präraffaelitischen Gemälden entwickelte ich eine Vorliebe für Edward Burne-Jones, Dante Gabriele Rossetti und J. W. Waterhouse sowie die Bildthemen aus der englischen Literatur und Mythologie. Dagegen konnte ich weder den Landschaftsdarstellungen noch den religiösen Kompositionen viel abgewinnen. Vor allem die religiösen Gemälde von William Holman Hunt wie „Das Licht der Welt“ oder „Der Sündenbock“ empfand ich als unsäglich. Auch mit John Everett Millais hatte ich meine Probleme. Einige seiner Gemälde wie z. B. „Ophelia“ gefielen mir, andere hatten für meinen Geschmack die Grenze zum Kitsch überschritten.
Eine einzige Ausnahme gibt es im Werk von Holman Hunt, die ich sehr schätzte: „Die Lady von Shalott“. Der Titel bezieht sich auf das gleichnamige Gedicht von Tennyson, dem eine mittelalterliche Erzählung als Vorlage diente. Die Lady von Shalott lebt allein in einem Turm auf einer kleinen Insel mitten in einem Fluss, der nach Camelot fließt, wo König Arthus Hof hält. Durch einen Fluch gebannt, darf sie weder den Turm verlassen noch durch ein Fenster hinausblicken und erlebt die Außenwelt mit den Türmen des fernen Camelot nur durch einen Spiegel. Ihre Zeit verbringt sie damit, die Bilder, die der Spiegel zeigt, zu einem endlosen Teppich zu verweben. Eines Tages erblickt sie im Spiegel den vorbeireitenden Ritter Lancelot und vergisst den Fluch. Um Lancelot besser sehen zu können, tritt sie ans Fenster und verliebt sich in den Ritter. In diesem Augenblick zerbricht der Spiegel, und sie weiß, dass der Fluch in Erfüllung gehen wird. Trotzdem besteigt sie ein Boot, um dem Ritter zu folgen, und treibt den Fluss hinunter. Doch je weiter sie sich von ihrer Insel entfernt, desto mehr schwinden ihre Lebenskräfte. Sterbend erreicht sie Camelot, wo Lancelot bei ihrem Anblick nur die triviale Bemerkung macht, sie habe ein hübsches Gesicht gehabt.
Dieses Gedicht hatten wir im Englisch-Unterricht in der Unter- oder Oberprima gelesen, und es hatte mir damals ausnehmend gut gefallen, vermutlich auch deshalb, weil es diesen Bezug zur Arthus-Sage hatte, deren frühe Kenntnis ich einem Prinz Eisenherz-Comic aus meiner Volksschulzeit verdanke, genauer gesagt meinem Banknachbarn in der dritten Klasse, der eines Tages einen Band mit Prinz Eisenherz-Abenteuern mitbrachte. (Der Band mit einem dunkelblauen Reliefumschlag stammte von der Illustrierten Woche aus dem Badischen Verlag, war vermutlich 1950 oder 1951 gedruckt worden und enthielt die Originalseiten 120-169. Er begann mit der Belagerung der Burg Andelkrag und brach mit der Hochzeit von Hulta und Jago ab. Wie ich während der Schulzeit weitere Kenntnisse über König Arthus und seine Tafelrunde erhalten habe, entzieht sich meiner Erinnerung, auf jeden Fall aber war ich mit den Zusammenhängen vage vertraut, als wir Tennysons Gedicht durchnahmen.)
Für sein Bild der Lady von Shalott hatte Hunt bereits in den 1850er Jahren erste Skizzen gemacht, sie aber beiseitegelegt, weil sie Tennyson nicht gefielen. 1895 nahm er die Arbeit an dem Gemälde auf und vollendete es erst 1905, also zehn Jahre später. Es ist ein wunderbares Bild geworden und hält den Augenblick fest, in dem die Lady von Shalott im Spiegel Lancelot sieht, vom Webstuhl aufspringt und aus dem verbotenen Fenster in die Welt blickt. Ihre Haare sind in wilder Bewegung, und nach einer Anmerkung von Christopher Wood in seiner Monographie „The Pre-Raphaelites“ dauerte allein die Anfertigung der Haarperücke drei Jahre.
Mir ist das Gemälde zum ersten Mal etwa zehn Jahre nach dem Abitur in einem Buch über die Präraffaeliten begegnet. Seit der Zeit (also seit ca. 40 Jahren) wollte ich dieses Bild im Original sehen, da es jedoch in Hartford, Connecticut hängt, wo man normalerweise nicht hinkommt, blieb es bei dem Wunsch. Jetzt ist es zum ersten Mal seit über 50 Jahren wieder in Europa zu sehen, in einer umfassenden Ausstellung über präraffaelitische Malerei in der Tate in London. Die Ausstellung ist in sieben Themen und Räume gegliedert. Dabei hat Hunts Lady of Shalott im siebten Raum eine ganze Wand für sich und wird von einigen sehr schönen Bildern Rosettis und Burne-Jones' begleitet.
Ich war schon morgens vor der Öffnung an der Tate, war einer der ersten Besucher, ging sogleich in den letzten Raum und hatte die Lady mindestens zwanzig Minuten für mich allein. Trotz einiger kitschverdächtiger Details hat mich das Bild sehr beeindruckt. Die Körperhaltung der Frau, ihr geneigter Kopf mit der wilden Haarmähne und die Gesamtkomposition des Turmzimmers mit dem Spiegel in der Mitte sind sehr gelungen. Die Lady von Shalott ist Höhepunkt und Abschluss der viktorianischen Malerei – aber auch schon aus der Zeit gefallen.
(Dez. 2012)
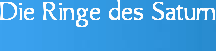
Jahrzehntelang hatte ich mit dem Namen Sebald ausschließlich die Nürnberger Sebalduskirche und ihren schönen Hallenchor verbunden, bevor ich im Abstand einiger Jahre mehrmals in englischen Texten auf einen deutschen Autor namens W. G. Sebald und sein Buch „Die Ringe des Saturn“ hingewiesen wurde. In einem Fall wurden „Die Ringe des Saturn“ als outstanding bezeichnet, in einem anderen Fall Sebald als zukünftiger Kandidat für den Literaturnobelpreis. Das Buch „Die Ringe des Saturn“ sei an der Oberfläche ein Reisebereicht eines melancholischen Erzählers seiner Wanderung durch Suffolk, tatsächlich jedoch durch die eingefügten Fotos und die Bezüge auf historische Ereignisse und Personen, bei denen Fakten und Fiktion wie bei Borges durchmischt seien, eine neue Form des Romans.
Beginnt man, den in zehn Teile gegliederten Roman zu lesen, wundert man sich zunächst, warum der Autor ausgerechnet die langweilige und kunstarme ostenglische Landschaft ausgewählt hat, dann aber eröffnet er das Spiel der Verzweigungen, aus einer zufälligen Erinnerung heraus wird eine Lebensgeschichte erzählt, und aus einer Nebenbemerkung entsteht eine zweite. So kommt er vom Tod eines Bekannten zu Madame Bovary und von ihr zur Irrfahrt eines Schädels eines englischen Arztes aus dem 17. Jahrhundert und zur Anatomiestunde des Dr. Tulp in Amsterdam und macht bei der Beschreibung des bekannten Gemäldes von Rembrandt die Entdeckung, dass die Blicke der Ärzte nicht auf den geöffneten Leichnam gerichtet sind, sondern auf einen ausgeklappten anatomischen Atlas, offenbar um nicht die entsetzliche Körperlichkeit des Toten sehen zu müssen …
Im fünften Teil nimmt er eine BBC-Sendung über eine Hinrichtung im Jahr 1916 zum Anlass, über Josef Konrad Korzeniowski zu schreiben, aus dem später Joseph Conrad wurde. Großen Raum gibt er der Kongoreise, deren Tagebuch die Grundlage für seine Erzählung „Das Herz der Finsterniss“ wurde. (Dass die wiederum von Francis Coppola für seinen Film „Apocalypse Now“ verwendet wurde, gehört zu den Trivialitäten, die Sebald nicht für erwähnenswert hält.)
Im zehnten Teil lässt er sich auf eine ausführliche Erörterung der Seidenraupenzucht in Europa ein, berichtet von den Versuchen in Frankreich zur Zeit Heinrich IV. und von den Anstrengungen in Deutschland. Zu den interessantesten Passagen des Buches gehört die Stellungnahme des Duc de Sully, die Sebald dem sechzehnten Band seiner Memoiren aus einer Ausgabe aus dem Jahr 1788 entnommen hat, die er antiquarisch in einem englischen Landstädtchen erworben hatte. Sully sah im Seidenbau die Gefahr der Degeneration der Landbevölkerung, nämlich dadurch dass das Landvolk, aus dem seit jeher die besten Musketiere und Kavalleristen sich rekrutierten, durch den Seidenanbau seine kräftige für das Staatswohl für unverzichtbar erachtete Konstitution einbüßen würde und infolgedessen mit dem zur Ausübung der militärischen Kunst nötigen Nachwuchs bald nicht mehr zu rechnen wäre …
Den Höhepunkt des Buches erreichte Sebald aus meiner Sicht im achten Teil mit einer elegischen und sprachlich wirklich schönen Beschreibung des Niedergangs der Familie Ashbury auf ihrem irischen Landgut als Folge des Bürgerkriegs. Bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit war er dorthin verwiesen worden. Statt einer Nacht bleibt er länger und gewinnt den Eindruck, dass die Ashburys unter ihrem eigenen Dach wie Flüchtlinge leben, die Furchtbares durchgemacht haben und es nicht wagen, an dem Platz, an dem sie gestrandet sind, sich niederzulassen …
Ein schön geschriebenes Buch mit altmodisch verschachtelten Sätzen, ein Genuss! Zu den verwendeten Quellen findet man im Netz viele Hinweise und Zusammenstellungen, z. B. in der Public Domain Review: publicdomainreview.org/collections/texts-in-sebalds-the-rings-of-saturn/
(Nov. 2012)
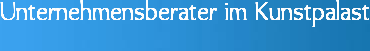
Als die Nachricht durch die Presse ging, in Düsseldorf sollten Kunstpalast und Oper von Unternehmensberatungen auf Rationalisierungspotentiale durchleuchtet werden, schrieb ich dem Oberbürgermeister einen Brief:
„Zu dem Auftrag an Unternehmensberatungen, Rationalisierungspotentiale im Museum Kunstpalast und in der Oper aufzudecken, möchte ich eine Anekdote beisteuern, die ich vor etwa 30 Jahren gehört habe und nachfolgend aus dem Gedächtnis gekürzt wiedergebe:
Ein junger, dynamischer Unternehmensberater, Associate bei McGuffin, MacKintosh and Company, der im Auftrag des Geschäftsführers einer Firma seit einigen Wochen nach Verbesserungsmöglichkeiten in der Organisationsstruktur und den internen Abläufen suchte, erhielt nach einer Routinebesprechung von dem Geschäftsführer das Angebot, am Abend ein Sinfoniekonzert zu besuchen. Er habe, sagte der Geschäftsführer, eine Karte für die Aufführung eines berühmten Orchesters, sei aber bedauerlicherweise verhindert. Gegeben werde unter anderem die nur selten aufgeführte Alpensinfonie von Richard Strauss. Der Berater nahm die Karte aus Höflichkeit an.
Am nächsten Morgen fragte der Geschäftsführer den Berater, ob ihm die Darbietung gefallen habe. Statt einer Antwort überreichte ihm der Berater ein schriftliches Memo. Darin stand:
- „Das Sinfonieorchester bestand aus über 100 Musikern. Ich habe mindestens 50 Streichinstrumente und ein unzählbares Durcheinander von Blasinstrumenten, darunter mindestens 16 Hörner, gezählt. Darin steckt ein enormes Rationalisierungspotential. Meiner Überzeugung nach würde es genügen, eine Instrumentengruppe durch 1, max. 2 Instrumente vertreten zu lassen. Dadurch könnten auch Qualität und Kompetenz des jeweiligen Musikers besser beurteilt werden, weil Fehler und Unsauberkeiten im Spiel in einer großen Gruppe nicht auffallen, wohl aber beim Solisten.
- Weiter ist mir aufgefallen, dass Melodien und Motive mehrmals wiederholt oder von anderen Instrumentengruppen aufgenommen werden. Das scheint mir eine völlig überflüssige Verzögerung im Ablauf der Darbietung zu sein. Ich empfehle nachdrücklich, auf diese ständigen Wiederholungen zu verzichten. Dieser Verzicht hätte darüber hinaus den Vorteil, dass die Dauer des Konzerts drastisch verkürzt werden könnte und dass dadurch das Orchester die Gelegenheit erhielte, im Verlauf des Abends eine zweite und dritte Aufführung zu veranstalten, wodurch auch die Einnahmen durch den Verkauf an Eintrittskarten verdoppelt und verdreifacht werden könnten.
- Bei einem kleinen, gut eingespielten Team von Musikern braucht man einen Dirigenten nur noch für die Proben, bei der Publikumsaufführung wäre er überflüssig. Das erspart Honorar und hätte darüber hinaus den Vorteil, dass er die Zuhörer nicht andauernd mit seinem Armgefuchtel irritiert und ablenkt.
- Schließlich ist mir bei einer der Darbietungen des Abends aufgefallen, dass sehr viele Achtel- und Sechzentelnoten gespielt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das Erlernen des sauberen Spiels unterschiedlicher Notenlängen schwierig und aufwendig ist. Mein Vorschlag dazu ist, die Notenlänge grundsätzlich zu harmonisieren und anzugleichen.
Würde man all diese einfachen Vorschläge umsetzen, wäre – dessen bin ich mir sicher – ein enormes Rationalisierungspotential zu erreichen. Allein in Deutschland dürfte es – nach einer von mir heute nacht durchgeführten Grobschätzung – über 100 Orchester mit über 5000 Planstellen geben. Davon könnten meiner Auffassung nach 3/4 eingespart werden.“
Ob der Berater nach diesem Memo in der Firma weiterbeschäftigt wurde, ist nicht überliefert. Bietet diese Anekdote eine Moral oder einen Transfer? Ja, hat sie: Wenn in einer kleinen Organisation wie dem Kunstpalast, in der die Aufgabenerledigung noch auf Zuruf erfolgen kann und jeder jeden kennt, der kaufmännische Leiter nicht bemerkt, dass zwei verschiedene Abteilungen identische Arbeiten durchführen und sich nicht einmal abstimmen (so stand es wenigstens in den Zeitungen), dann fehlt ihm nicht nur die Befähigung für den Job, sondern dann muss man auch fragen, wer ihn eigentlich ernannt hat und wer eine Kontrollfunktion ausübt. Gleichzeitig ist natürlich die Frage zu stellen, warum man einen Unternehmensberater braucht, um Doppelarbeiten festzustellen. Wenn aber Sie, der Oberbürgermeister, nach dem ersten Wind der Kritik erklären, Sie verstünden nicht, warum (oder seien damit nicht einverstanden, dass) der Kunstpalast in kurzer Folge hintereinander zwei Ausstellungen durchführt, dann scheinen Sie sich vorher nie die Jahresplanung angesehen zu haben, oder Sie wollen nur auf den fahrenden Zug springen und schnell noch Anführer der Bewegung werden …“
Da mich der Hafer stach, habe ich die Anekdote auch einem bekannten Zeitungsredakteur geschickt – mit folgendem Anhang:
„… Die Erinnerung an diese Anekdote brachte mich darauf, Ihnen einen entsprechenden Vorschlag zur Rationalisierung von Kunstausstellungen zu unterbreiten. Man braucht doch nur das aus Andersens Märchen Des Kaisers neue Kleider bekannte Prinzip auf Ausstellungen zu übertragen. Konkret: Man hängt nur noch weiße Leinwände auf und wechselt lediglich die losen Blätter mit den Bildbeschreibungen. Damit erledigt sich das leidige Thema der Ausleihen und höchst teuren Transportversicherungen. Außerdem könnte man dem Publikum immer die jeweils wichtigsten Originalwerke präsentieren. Jüngst in der El Greco-Ausstellung z. B. hätte man Hauptwerke zeigen können, die nicht ausgeliehen wurden, wie die Ansicht von Toledo mit Gewitterhimmel und der Großinquisitor Kardinal Don Fernando Niño de Guevara (beide im Metropolitan New York). Und für diejenigen unter den Besuchern, die die Originale nicht kennen oder sich nicht vorstellen können, könne man im Internet ein Daumenkino anlegen, wo man die Bilder im Format 3 x 4 mm detailliert studieren könnte. Sehr geehrter Herr X*, Sie sind in Düsseldorf gut vernetzt und kennen den Oberbürgermeister, die Aufsichtsratsvorsitzenden, Präsidenten, Direktoren, Geschäftsführer und kaufmännischen Leiter aller Museen. Es dürfte Ihnen ein leichtes sein, diese Herrschaften von den Vorteilen des Andersen-Prinzips zu überzeugen.“
Auf beide Briefe erhielt ich keine Antwort.
(Im Okt. 2012)
Wann und wo mir zum ersten Mal der Name des Japanischen Schriftstellers Haruki Murakami begegnete, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kaufte ich 2008 in London seinen Roman „Kafka on the Shore“. Ich las ihn an, konnte aber nichts mit dem Text anfangen und stellte ihn ins Regal ohne Absicht, mich später noch einmal mit ihm zu beschäftigen. Möglicherweise beruhte der Kauf auch auf einem peinlichen Missverständnis, möglichweise hatte ich nämlich den Titel verwechselt und an „Als Freud das Meer sah“ gedacht, diese grandiose Analyse von Georges-Arthur Goldschmidt über Freud und die deutsche Sprache, die sich schon seit Jahren unter den Büchern meiner Frau befand.
Murakami wurde ich aber nicht los. Im Jahr 2010 wurden Teil 1 und 2 seines damals neuen Romans „1Q84“ in den Medien ausführlich besprochen und erweckten wieder meine Neugier. Als 2012 eine einbändige englische Taschenbuchausgabe des insgesamt dreiteiligen Romans auf den Markt kam, kaufte ich sie, fand beim Lesen sofort den Einstieg und las die Geschichte der Aomame ohne längere Unterbrechungen bis zum Ende. Aomame ist eine Auftragskillerin, die in Diensten einer älteren Dame Kinderschänder tötet. Während eines Verkehrsstaus verlässt sie auf einer Brücke die Stadtautobahn von Tokio und landet in einer Parallelwelt, deren Existenz sie erst daran erkennt, dass nachts zwei Monde über den Himmel wandern und das Fernsehen nichts über den Mord berichtet, den sie inzwischen begangen hat. Murakami erzählt, wie sie mit der Lage zurechtzukommen versucht, ihren Jugendfreund Tengo, den sie seit langem aus den Augen verloren hatte, wiedertrifft und schließlich mit ihm in das Tokio ohne zweiten Mond zurückkehrt. Eine wichtige Rolle spielen eine Sekte und ihr geheimnisvoller Anführer, für die vermutlich die Aum-Sekte und ihr Giftgasanschlag im Jahr 1995 die Vorlage abgaben. Murakami erzählt abwechselnd aus zwei Blickwinkeln, aus der Sicht von Aomame und aus der Sicht von Tengo, der Schriftsteller geworden ist und die Machenschaften der Sekte aufzudecken versucht; im dritten Teil kommt ein weiterer Blickwinkel dazu. Der Roman ist spannend und liest sich flüssig. Einer der Schreibtricks von Murakami besteht darin, dass er regelmäßig kurze Wiederholungen einstreut, wodurch der Leser, sollte er das Buch für einige Zeit beiseite gelegt haben, sich schnell wieder in der Geschichte zurechtfindet.
Der Roman wurde in den deutschsprachigen Medien überwiegend positiv besprochen, u. a. in der FAZ, der Süddeutschen, der Zeit und einschränkend in der NZZ. Viel kritischer fiel die Besprechung in der New York Times aus.
Als naiver Leser kann ich mir erlauben zu sagen, dass mir der Roman gefallen hat. Wahrscheinlich gefiel mir die Geschichte deshalb so gut, weil mich die Hauptfigur an die Frauen aus meinen Romanen erinnert, an Sigrun in „Sigfrieds Tochter“ und die wesensverwandte Solveig Solness in „2101“.
(Aug. 2012)
Als Auguste Racinet sein Weltarchiv über die Entwicklung der Mode zusammenstellte und nach Jahren des Sammelns und Zeichnens unter dem Titel „Le costume historique“ 1888 als sechsbändige Buchausgabe herausbrachte, scheint er die Fresken im Rittersaal des Kastells Manta nicht gekannt zu haben. Zumindest bin ich bei der Durchsicht der Neuausgabe des Taschen Verlags aus dem Jahr 2004 auf keine Zeichnungen höfischer Mode aus dem 15. Jahrhundert gestoßen, die den Kleidern der auf den Fresken dargestellten Personen ähnelten. Was nicht unbedingt verwundert: Kastell Manta ist eine kleine Burg bei Saluzzo südlich von Turin und liegt weitab vom Schuss. Ausgemalt wurde der Rittersaal gegen 1420 mit einer Darstellung des Jungbrunnens auf der Fensterseite und mit achtzehn überlebensgroßen Figuren, neun Männern und neun Frauen, auf der gegenüberliegenden Wand. Der Künstler ist unbekannt, bekannt ist dagegen, dass er sich thematisch an den allegorischen Roman „Le Chevalier Errant“ hielt, der von Tommaso III. Markgraf von Saluzzo verfasst worden war. (Googelt man heute „Le Chevalier Errant“, stößt man zunächst auf eine Novelle des Fantasy-Autors George R. R. Martin, was einer gewissen Ironie nicht entbehrt, weil der durchschnittliche Liebhaber mittelalterlicher Fresken wohl kaum die Buchreihe oder die Fernsehserie „Game of Thrones“ kennt und der durchschnittliche Fan der Buchreihe oder der Fernsehserie wohl kaum die Fresken von Manta. Hand aufs Herz: Bei dem Wort Manta denkt man zuerst an das Automodell von Opel aus den 70er und 80er Jahren oder an einen Rochen, aber kaum an eine kleine Burg an den östlichen Ausläufern der Seealpen. Mir wenigstens war das Kastell Manta nicht bekannt, und ich habe den Besuch dem Kreis der Freunde des Instituts für Kunstgeschichte an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf zu verdanken, dessen Reiseplaner das Kastell in eine Piemont-Reise aufgenommen hatten.)
Die spätgotischen Fresken von Manta gehören zu den wertvollsten Beispielen höfischer Kunst des frühen 15. Jahrhunderts und spiegeln die Mode am Hof Karls VI. von Frankreich, vielleicht auch vom burgundischen Hof in Dijon. An dieser Stelle erlaube ich mir eine weitere Abschweifung mit einem Blick auf die Zeit: Im Jahr 1420, in dem vermutlich diese Fresken gemalt wurden, vergaben der Kaufmann Joost Vijd und seine Frau Elisabeth Borluut den Auftrag für den Genter Altar, war das Konzil von Konstanz seit zwei Jahren zu Ende, regierte im Heiligen Römischen Reich König Sigismund, hatten die Hussitenkriege begonnen, verbündete sich Philipp III. Herzog von Burgund im Vertrag von Troyes mit Heinrich V. von England gegen Frankreich und war Johanna, die Jungfrau von Orléans, acht Jahre alt. Jetzt könnte man darüber spekulieren, wie ihr Leben Johannas verlaufen wäre, hätten sich Burgund und England nicht gegen Frankreich verbündet.
Zurück zum Rittersaal in Manta: Die Wand der Fensterseite bedeckt ein Fresko mit der Legende des Jungbrunnens, dabei wird wegen der beiden Fenster die Geschichte in drei Teilen erzählt. Links werden die Alten auf Karren oder in Wagen zum Brunnen gebracht, in der Mitte erfolgt die Verjüngung im Brunnen, wobei bereits wieder zahlreiche amouröse Verbindungen geknüpft werden, und rechts ziehen die Verjüngten von dannen.
Auf der gegenüberliegenden Wand wird der Blick des Besuchers von den großen Figuren gefangengenommen. Die neun männlichen Figuren sind einerseits Porträts von neun Markgrafen von Saluzzo und stellen andererseits mythologische und historische Könige dar, darunter Alexander den Großen, Julius Cäsar, Artus und Karl den Großen. Die neun weiblichen Gestalten sind entsprechend Porträts ihrer Ehefrauen und zugleich mythologische Personen, darunter Semiramis, Hippolyta, Penthesilea und die Nymphe Sinope, der Zeus vergeblich nachjagte. Die Namen der anderen Figurensind mehrdeutig – zur Klärung müsste man vermutlich im „Chevalier Errant“ nachschlagen.
Mit einer Ausnahme tragen die Männer über ihrer Rüstung ein kurzes Oberkleid und als Kopfbedeckung eine Krone oder einen Blumenkranz. In den Händen halten sie ein Schwert und andere Insignien ihrer Macht, und am Ast eines Baumes hängt jeweils ihr Wappen. Die Frauen tragen bodenlange Kleider und darüber einen Übermantel, als Kopfbedeckung phantasievolle Hauben oder auch eine Krone. Um Monotonie zu vermeiden, hat der Künstler jeder Figur eine individuelle Körperhaltung, eine andere Neigung des Kopfes und Blickrichtung gegeben. Darüber hinaus hat er die Farben der Gewänder von Dunkelblau über Rot bis zu Gelb und Weiß mit wunderbaren Mustern und Stoffanmutungen variiert – besonders schön bei Semiramis und Hippolyta. Er hätte heute bei der Haute Couture die allerbesten Chancen.
Dass man diese wunderbaren Fresken heute bestaunen kann, als seien sie erst kürzlich in aller Frische aufgetragen worden, haben wir den Zufällen der Geschichte zu verdanken. Das abgelegene Kastell wurde im Lauf der Geschichte mehr oder weniger vergessen, war seit dem 16. Jahrhundert Teil von Savoyen, hatte keine Bedeutung mehr und geriet nie in Gefahr, entsprechend dem Zeitgeschmack modernisiert zu werden, was zur Übermalung oder Zerstörung geführt hätte.
Ein weiterer Höhepunkt der Reise des Freundeskreises war die Abteikirche der heiligen Maria von Vezzolano. Sie liegt auf halber Strecke zwischen Turin und Asti versteckt im Gebirge – also ebenfalls weitab vom Schuss – und ist noch unbekannter als Kastell Manta, was man daran ablesen kann, dass es in der deutschen Wikipedia keinen Artikel über sie gibt. Der Sage nach wurde die erste Kirche an dieser Stelle schon zur Zeit Karls des Großen errichtet und von ihm als Station auf dem Weg nach Rom benutzt. Das jetzige Bauwerk stammt aus dem 13. Jahrhundert und gilt als eine der schönsten Klosterkirchen des Piemont mit einer außerordentlich schön gegliederten romanischen Westfront und einem figurenreichen Lettner.
Insgesamt wurden auf der Reise siebzehn Kirchen besichtigt, wovon ich nur noch eine erwähnen möchte: die Abteikirche des heiligen Michael im Tal von Susa westlich von Turin. Genau genommen liegt sie nicht im, sondern hoch über dem Tal in einer Höhe von fast 1000 m auf einem wildromantischen Berggipfel, von dem man weit ins Tal und in Richtung Turin blicken kann. An der Stelle, auf der vermutlich schon die Römer einen Wachtturm und später die Langobarden eine Befestigung errichtet hatten, wurde um das Jahr 1000 mit dem Bau der Kirche begonnen. Bei späteren Erweiterungen reichte der Platz nicht, weshalb bis zu 40 m hohe Stützmauern und Pfeiler errichtet wurden mussten. Dadurch entstand eine burgartige Anlage, die an den Mont-Saint-Michel in der Normandie erinnert. Ich wüsste aber nicht zu sagen, welche ich imponierender finde.
(Juni 2012)

Anlässlich der Eröffnung seines Erweiterungsbaus präsentiert der Städel Frankfurt in einer Sonderausstellung, die in der Presse eine große Resonanz gefunden hat, 130 Werke von Claude Lorrain. Claude war schon zu Lebzeiten berühmt und geriet auch nicht zwischenzeitlich in Vergessenheit wie z. B. sein Zeitgenosse Georges de la Tour. Claude gilt als einer der größten Landschaftsmaler und als Erfinder der „Ideallandschaft“, obwohl er nach der Schilderung seines Biografen Joachim von Sandrart häufig Naturstudien betrieb und seine Eindrücke in Zeichnungen festhielt. Von Sandrart wissen wir auch, dass Claude Gillis (so sein ursprünglicher Familienname – erst später wurde daraus Gellée) um 1600 in einem Dorf bei Nancy in Lothringen geboren wurde. Das Herzogtum Lothringen war seit dem 9. Jahrhundert Teil des Heiligen Römischen Reiches (die Ostgrenze Frankreichs verlief jahrhundertelang westlich einer Linie Verdun-Toul-Dole) und blieb es auch nach Claudes Geburt weitere 160 Jahre. Erst 1766 wurde Lothringen legaler Bestandteil von Frankreich. Deshalb ist es auch nicht angebracht, Claude als französischen Barockmaler einzustufen. Korrekt wäre, ihn als einen aus Lothringen stammenden Maler des italienischen Barocks zu bezeichnen.
Nach dem frühen Tod seiner Eltern zog er zu seinem Bruder nach Freiburg im Breisgau und lernte das Handwerk des Pastetenbäckers, bevor er einige Jahre später nach Rom reiste, wo er, abgesehen von zwei kurzen Perioden, auch bis an sein Lebensende blieb. Als Maler war er mit seinen Bildern bald sehr erfolgreich und konnte den Papst, mächtige Kardinäle und europäische Fürsten zu seinen Auftraggebern zählen. Dabei schuf er ein umfangreiches Œuvre von rund 250 Gemälden, 1.200 Zeichnungen und 44 Druckgrafiken. Auch Engländer begannen früh, seine Werke zu sammeln, und sie hatten einen großen Einfluss auf die englische Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts, vielleicht sogar auch auf die Landschaftsgestaltung (aber das ist eine Spekulation von mir). Da er in Rom Bekanntschaft mit dem etwas älteren Poussin schloss, wird in französischen Lebensbeschreibungen daraus gern ein Lehrer-Schüler-Verhältnis abgeleitet, wofür es aber keine Belege gibt. Stilistische Einflüsse von Poussin im Werk Claudes sind nicht zu erkennen. (Poussin war ein viel besserer Figurenmaler, seine Landschaften wirkten dagegen oft konstruiert.) Als Künstler steht er vielmehr in der Tradition der italienischen Landschaftsmalerei, wie sie in der Hochrenaissance in Venedig entstanden ist. Diese Ansicht vertritt die Encyclopedia of Art mit der Beurteilung: “Claude Lorrain spent his whole working life in Italy, and his work must be examined in the context of the Roman school of Baroque art.”
1988 gab es in der National Gallery in Washington eine große Ausstellung zur Landschaftsmalerei unter dem Titel: “Places of Delight - The Pastoral Landscape from Giorgione to Matisse." Die Ausstellung war in 6 Kapitel gegliedert, dabei wurde Claude unmittelbar mit Domenichino und Annibale Carracci verglichen und in die Tradition der venezianischen Landschaftsmalerei gestellt. Das Kapitel über Claude Lorrain begann im Katalog wie folgt: “Around 1600 Annibale Carracci led the classical reorganization of the pastoral vision of landscape, whose original form was a legacy of the Venetian High Renaissance." In der Ausstellungsgliederung folgte auf Claude Rubens. Einleitung dazu: "The energetic revival of the Venetian landscape tradition by Rubens ..." Bildbeispiel war u. a. das bekannte "Bauernhaus bei Sonnenuntergang". Ein Vergleich Claudes mit Poussin oder einem anderen französischen Maler des 17. Jahrhundert fand nicht statt, und von einer Einstufung Claudes als Maler des französischen Barock war an keiner Stelle die Rede.
Im Jahr 2008 veranstaltete das Metropolitan Museum in New York eine große Ausstellung über "Poussin and Nature". Auch in dieser Ausstellung wurde keine Verbindung zwischen Poussin und Claude Lorrain hergestellt, ein Vergleich erfolgte nur beiläufig an zwei Stellen im Katalog.
Wie schon oben erwähnt, war die Presseresonanz auf die Frankfurter Ausstellung groß, wobei auch manche Merkwürdigkeit zu lesen war. So hieß es in der FAZ z. B. sinngemäß: „Vor Lorrain beschränkte sich die Landschaftsmalerei auf kleine Formate, die in den Stuben von Kaufleuten in Nordeuropa hingen. Landschaften waren hübsch anzuschauen, aber niemals erhaben." Da hat der Verfasser aber vieles vergessen. Außerdem ist die Bewertung „hübsch anzuschauen, aber niemals erhaben“ ziemlich verwegen. Mit dem Begriff des „Erhabenen“ begibt man sich in schwieriges Gelände, ohne dem Leser eine Landkarte zur Deutung mitzugeben (die Zeiten, in denen man sich in der Schule mit Schillers Text beschäftigen musste und später Adornos Ästhetische Theorie in der Tasche mit sich herumtrug, sind schließlich lange vorbei), und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Museumsbesucher eine nachvollziehbare Definition des Erhabenen liefern und darüber hinaus erklären könnten, warum ein idyllisches Gemälde von Claude mit grasenden Schäfchen erhabener sein sollte als ein vergleichbares Bild von Rubens, Carracci oder Domenichino.
(Im März 2012)
In drei berühmten Romanen der Weltliteratur des 19. Jahrhunderts, die einen Ehebruch und seine Folgen behandeln (Emma Bovary, Anna Karenina und Effie Briest), bestrafen die Autoren ihre Heldinnen am Ende mit dem Tod. Flaubert ließ Emma Bovary Gift nehmen, bei Tolstoi musste Anna Karenina sich vor einen Zug werfen, und bei Fontane welkte Effie Briest einfach kraftlos dahin. Alle drei Autoren verwendeten für ihre Romane zeitgenössische Vorfälle als Vorlage. Flaubert den Selbstmord der Delphine Delamare, die einer Zeitungsnotiz zufolge mit einem unbedeutenden Landarzt verheiratet war, aus Langeweile die Ehe brach, Schulden machte und sich vergiftete, als sie erkannte, dass die Flucht aus ihrem Leben in eine Welt des schönen Scheins gescheitert war. Tolstoi hatte nach Vollendung von „Krieg und Frieden“ begonnen, einen historischen Roman über die Zeit Peters des Großen zu schreiben, als die Geliebte eines benachbarten Gutsbesitzers Selbstmord beging, indem sie sich vor einen Zug warf. Nach der Leichenschau, an der Tolstoi teilnahm, soll er den Gedanken gefasst haben, aus dem düsteren Ereignis einen zeitgenössischen Roman über die Idee der Familie zu machen. Auch Theodor Fontane griff für seinen Roman eine Ehetragödie auf, die mit einem Duell des preußischen Offiziers Armand von Ardenne mit einem Amtsrichter, dem er eine Affäre mit seiner Frau unterstellt hatte, großes Aufsehen erregt hatte. Die Geschichte um die junge Ehebrecherin faszinierte die Leser, und das Porträt der verwöhnten, aber im Unglück endenden Effie Briest wurde zu seinem größten literarischen Erfolg. In der Wirklichkeit dagegen starb Elisabeth von Ardenne nicht aus Trauer, Einsamkeit und Schuldgefühlen. Sie nahm ihr Leben in die Hand und wurde 99 Jahre alt.
Im Vergleich zu diesen berühmten Ehebrecherinnen ist Ana Ozores, die Hauptfigur des Romans „Die Präsidentin“, bei uns kaum bekannt, obwohl sie zu den großen Frauengestalten der europäischen Literatur gehört und Mario Vargas Llosa „Die Präsidentin“ als besten spanischen Roman des 19. Jahrhunderts bezeichnet hat.
Die Handlung spielt in Oviedo, im Roman Vetusta genannt, einer langweiligen Provinzhauptstadt, deren gesellschaftliches Leben vom konservativen Klerus und von den Spielregeln der Feudalgesellschaft beherrscht wird. Ana Ozores ist mit dem wesentlich älteren Gerichtspräsidenten Victor Quintanar verheiratet, der ihre Bedürfnisse nach Liebe nicht erfüllen kann. Zu ihrem Unglück wird sie zu einem Objekt der Begierde in einen Machtkampf zwischen ihrem Beichtvater, dem ehrgeizigen, abgründigen Generalvikar Don Fermin, und Don Alvaro, einem stadtbekannten Frauenverführer. Unter dem Einfluss des Klerikers gerät sie zunächst immer tiefer in religiöse Schwärmerei und in Zustände mystischer Verzückung, bis sie erkennen muss, dass der Geistliche sie in sexueller Leidenschaft begehrt. Da ihr Gatte ihr auch nach schwerer Erkrankung weiterhin nur mit Gleichgültigkeit begegnet, erliegt sie den Verführungskünsten Don Alvaros, den es reizt, die schönste und faszinierendste Frau der Stadt zu erobern. Nach dem Ehebruch kommt es zu einem Duell, in dem Alvaro den Gerichtspräsidenten tödlich verletzt. Während Alvaro nach Madrid flieht, wird Ana von der Gesellschaft, deren neidische Bewunderung ihr einmal galt, mit Häme verstoßen. Sie schließt sich in ihr Haus ein, stirbt aber nicht, das Ende bleibt offen. Als Leser wünschte man ihr die Tatkraft, die Elisabeth von Ardenne ausgezeichnet hat.
Verfasst hat den Roman der spanische Autor Leopoldo Alas (1852 – 1901) und unter dem Pseudonym Clarin veröffentlicht. Leopoldo Alas hatte Jura studiert, war jahrelang Professor für Römisches Recht an der Universität von Oviedo und publizierte all seine schriftstellerischen Arbeiten unter dem Decknamen Clarin. Diesen Namen hatte er vermutlich nach der Figur des Schelmen aus Calderóns Theaterstück „Das Leben ein Traum“ gewählt.
Die Veröffentlichung des Romans rief in den konservativen Kreisen Spanien große Entrüstung hervor. Man warf dem Autor Unsittlichkeit vor, und manche Kritiker wollten ihn mit der Bemerkung kleinreden, Clarin habe Flaubert kopiert. Obwohl gewisse Parallelen zu Madame Bovary unleugbar sind, sind doch deutliche Unterschiede in der Behandlung des Ehebruchs und des gesellschaftlichen Umfeldes festzustellen. Clarin gibt der Darstellung der geistigen Enge der Restauration unter König Alfons XII., den Intrigen, den Fassaden, hinter denen sich Missgunst und Hass verbergen, und ebenso der allmächtigen Stellung der Kirche mit der Förderung bigotter Glaubensvorstellungen viel Raum. Bezeichnenderweise beginnt und endet der Roman im Dom, wobei besonders das Eröffnungskapitel beim Leser einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Das erbarmungslos genau gezeichnete Milieu Vetustas ist der Hintergrund, vor dem sich das Drama Anas abspielt und der den Leser ihr Gefühl der Hoffnungslosigkeit und ihre Bedrückung, in einem Gefängnis starrer gesellschaftlicher Ordnung zu leben, glaubhaft nachempfinden lässt.
Vergleicht man die vier Romane stilistisch und im Hinblick darauf, wie die Autoren ihre Hauptfiguren behandeln, fallen große Unterschiede auf – besonders zwischen Flaubert und Fontane. Fontane erzählt die Geschichte der Effi Briest fast im Plauderton, unaufgeregt, ohne Pathos und mit distanzierter Ironie. Er erhebt weder eine direkte Anklage, noch wirft er eine Schuldfrage auf, hat aber trotzdem eine scharfen Blick für die gesellschaftliche und historische Situation. Stilistisch fällt auf, dass Fontane eine Reihe von wiederkehrenden Symbolen einsetzt, z. B. die Schaukel und die Wassermetaphorik. Von der Struktur her empfinde ich seinen Roman als unausgewogen, das Ende kommt plötzlich und wirkt wie angeklebt. (Vielleicht hängt das damit zusammen, dass er die Arbeit an dem Roman krankheitsbedingt unterbrechen musste.)
Stilistisch, von der Sehweise her und strukturell (chronologisch und topografisch) ist Madame Bovary der beste der vier Romane. Auffällig ist die kalte Distanz Flauberts seinen Figuren gegenüber, auffällig ist, dass Beschreibungen (z. B. von Räumen) sehr oft aus der Sichtweise (der Perspektive) der jeweiligen Person erfolgen und nicht aus der Sichtweise eines neutralen Beobachters. Während Flaubert strukturell dem klassischen Drama mit Aufstieg, Wendepunkt und Abstieg folgt, hat Alas eine ungewöhnliche, aber interessante Gliederung gewählt. Die Geschichte der Präsidentin besteht aus zwei Teilen mit jeweils fünfzehn Kapiteln, wobei die Handlung des ersten Teils drei Tage und die des zweiten Teils drei Jahre umfasst. Stilistisch erreicht Leopoldo Alas nicht die Meisterschaft Flauberts. Seine Anschlüsse und Übergänge wirken mitunter holprig, aber er kompensiert diese Schwächen mit seiner oft mit Spott durchsetzten Schilderung der korrupten und scheinheiligen Gesellschaft von Adel, Klerus und Bürgertum.
Wie nachhaltig die Empörung im konservativen Spanien war, musste noch 50 Jahre später sein Sohn im Spanischen Bürgerkrieg erfahren. Nach dem Einmarsch der siegreichen Franco-Truppen in Oviedo wurde er zur Strafe für die „Sünden“ seines Vaters erschossen.
(Im Januar 2012)
In den letzten Monaten habe ich einige visuell außergewöhnliche Filme gesehen (Another World, Melancholia, Sucker Punch), aber „Die Mühle und das Kreuz“ übertrifft sie alle.
„Die Mühle und das Kreuz“ ist ein Film des polnischen Regisseurs Lech Majewski, der Pieter Brueghels Gemälde „Kalvarienberg“ (auch „Kreuztragung“ genannt) zum Gegenstand hat. Das Bild aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien zeigt eine weite, offene Landschaft, die rechts leicht ansteigt und im Hintergrund durch eine schroffe Felsformation mit einer Windmühle auf der Spitze in zwei Teile getrennt wird. Links ist eine Stadt zu erkennen, rechts ein Richtplatz. Die Landschaft ist belebt: Etwa fünfhundert Personen sind abgebildet, die meistens wandern von der Stadt zum Richtplatz, auf dem die Menge schon einen Kreis um zwei aufgerichtete Kreuze gebildet hat. Genau im Mittelpunkt des Bildes, im Schnittpunkt der Diagonalen sieht man das dritte Kreuz und seinen unscheinbaren Träger. Es ist Christus, er ist gestürzt, mehrere Personen versuchen, ihn aufzurichten. Im Vordergrund rechts sind vier größere Figuren abgebildet: Johannes, Maria und trauernde Frauen.
Was macht Majewski mit dem Bild? Zu Beginn des Films stellt er das Bild als Tableau nach – als lebendes Bild, wie es zu Zeiten Goethes zur Unterhaltung von Gesellschaften der Brauch war. Dann jedoch greift er eine Gruppe von vielleicht einem Dutzend Personen heraus, folgt ihnen ins Bild hinein, dreht die Zeit einen Tag zurück und beginnt mit dem Morgen des Vortages: Waldarbeiter wählen einen Baum und fällen ihn sorgfältig – wir wissen schon wofür. Aus dem Frühnebel tauchen Reiter auf, und Mütter füttern ihre Kinder. Schnitt: Ein dunklen Raum, kaum zu erkennen drei schlafende Personen. Ein Mann steht auf und weckt einen anderen. Der steigt in der Dunkelheit eine zunächst nicht enden wollende Treppe hinauf (was den Eindruck erweckt, wir befänden uns in einer großen Höhle), bis er eine Tür öffnet und im Freien steht, dann einen Hebel bewegt, die Windmühle anwirft und die Welt von oben betrachtet. Jetzt verstehen wir, dass die bizarre Felsformation ausgehöhlt ist und dem Müller zur Wohnung dient. Schnitt: Die Reiter (spanische Soldaten in roten Röcken) verfolgen einen Flüchtenden, nehmen dann einen Bauern, der sein Kalb zum Markt führt, grundlos gefangen, brechen ihm die Knochen, binden ihn aufs Rad und überlassen ihn dem Tod und den Vögeln zum Fraß. Seine Frau weint und jammert, während ihrem Mann die Augen ausgehackt werden, aber da ist niemand, der zu Hilfe käme. Plötzlich taucht Brueghel auf. Er hat eine Staffelei dabei, setzt sich und beginnt das Bild, das wir betrachtet haben oder in dem wir uns befinden, zu zeichnen. Wieder ein Szenenwechsel. Vor einem Fenster eines Hauses in der Stadt steht die trauernde Maria. Sie weiß, dass sie das Schicksal ihres Sohnes nicht ändern kann. Im Hintergrund sieht man eine hohe Bergspitze, die aber auf dem Gemälde nicht vorkommt. Schnitt: Beim Zeichnen hat Brueghel Gesellschaft bekommen. Ein Kaufmann will das Bild erwerben, sie führen politische Gespräche. Weitere Personen werden gezeigt, zwei Stelzenläufer tauchen auf, und wir befinden uns immer wieder an anderen Stellen des Bildes und erblicken in der Ferne Landschaften, die auf dem Gemälde nicht vorhanden sind. Erst gegen Ende des Films wurde mir der Trick klar, mit dem Majewski gearbeitet hat: Um dem Betrachter den Eindruck unterschiedlicher Standorte zu vermitteln, hat er Ausschnitte aus einem halben Dutzend anderer Brueghel-Gemälde für den Hintergrund eingesetzt. Die Bergspitze beispielsweise, die man aus dem Fenster, vor dem Maria steht, erblicken kann, stammt aus der „Landschaft mit der Flucht nach Ägypten“, einem wenig bekannten kleinformatigen Gemälde aus der Sammlung Seilern, das heute in der Courtauld Gallery im Somerset House in London hängt. Dieser Trick ist übrigens keinem Rezensenten des Films aufgefallen.
Der Regisseur hat noch weitere Tricks auf Lager: Zum Beispiel tauchen (wie schon erwähnt) einmal zwei Stelzenläufer auf, und man glaubt (ich glaubte es zunächst auch), sie aus anderen Brueghel-Bildern zu kennen. Aber das ist eine Täuschung! Die Stelzenläufer sind frei erfunden. Bei Brueghel gibt nur einige auf ganz kurzen Stelzen. Oder nehmen wir den Kaufmann: Er ist eine historische Figur und war einer der größten Sammler von Brueghel-Bildern noch zu dessen Lebzeiten. Die politischen Gespräche, die die beiden im Film führen, könnten also durchaus so stattgefunden haben. Genial ist auch, den Müller in die Rolle des Weltenrichters schlüpfen zu lassen, der von seinem überhöhten Standpunkt auf der Mühle mehr oder weniger gleichgültig auf das grausame Geschehen blickt. Die Mühle mahlt das Korn, das Weltgeschehen nimmt seinen Lauf. Brueghels Gemälde war zweifelsohne eine einzige Anklage gegen die spanischen Besatzer und das Schicksal des Landes. Am Ende des Films erstarrt das Geschehen wieder zum ursprünglichen Bild, das wir dann an seinem Standort im Wiener Museum sehen. Wer Zeit hat, fahre hin, seine Wahrheit zu betrachten.
(Nov. 2011)
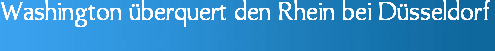
Unter dem Titel „Blicke auf Europa“ war 2007 in Brüssel eine umfangreiche Schau der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts zu sehen. Die Ausstellung stand unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin und galt als der kulturelle Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur EU-Ratspräsidentschaft in diesem Jahr. Ausgestellt waren rund 150 Gemälde, die ausschließlich aus deutschen Museen stammten und deren Auswahl aus einer Zusammenarbeit der Staatlichen Museen zu Berlin, der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München entstanden war.
Vertreten waren viele bekannte Künstler – mit vier Ausnahmen: Füssli, Hodler, Klinger und Thoma fehlten. Gezeigt wurden fast alle künstlerischen Strömungen des 19. Jahrhunderts. Aber das letzte Jahrzehnt (die 90er Jahre) war malerisch nicht präsent, und es fehlte ein Blick auf die Aufbruchstimmung am Ende des Jahrhunderts, zum Symbolismus und zum anbrechenden Jugendstil wurde leider kein Wort verloren. Ein Abschluss der Auswahl mit dem Gemälde "Frühlingssturm" von Ludwig von Hofmann aus dem jahr 1895 - einem Symbolbild des Jugendstils - und mit z. B. Klimts „Bildnis der Sonja Knips“ aus dem Jahr 1898 oder dem „Bildnis der Emilie Flöge“ aus dem Jahr 1902 hätte der Ausstellung gutgetan (auch wenn man dafür das Prinzip „nur aus deutschen Museen“ hätte aufgeben müssen), zumal die Kuratoren die Jahrhundertgrenze bei Liebermann, Slevogt und Sterl auch nicht eingehalten haben.
Die ausgewählten Gemälde waren nicht chronologisch gehängt, sondern entsprechend der Intention des Titels der Ausstellung (deutsche Maler blicken auf Europa oder setzen sich mit europäischen Strömungen auseinander) nach den Sehnsuchtszielen, nach dargestellten Regionen oder Themen: Griechenland (und griechische Mythologie), Italien, Der Norden – Skandinavien, Osteuropa, Böhmen, Alpenregionen, Spanien, Großbritannien (und die Porträtmalerei in der Nachfolge von Gainsborough), Belgien, Holland, Frankreich (und der Impressionismus) sowie als Sonderteil Adolph Menzel.
Wie auch schon bei anderen Ausstellungen, in denen Bilder in ein bestimmtes Korsett gezwängt werden, das nicht immer passt, sind aus dieser Anordnung einige Merkwürdigkeiten entstanden. So wurden z. B. zwei Kinderporträts von Runge ausgestellt, auf denen man beim besten Willen keinen besonderen Bezug zu Skandinavien entdecken kann.
Im Textteil des Katalogs wurden München, Berlin und Dresden als Drehscheiben der europäischen Malerei des 19. Jahrhunderts dargestellt, dagegen wurde die Düsseldorfer Malerschule nur beiläufig erwähnt – man kann auch sagen, dass sie übergangen wurde.
Jetzt läuft im Düsseldorfer Kunstpalast unter dem provozierenden Titel „Weltklasse – Die Düsseldorfer Malerschule von 1819 bis 1918“ eine umfangreiche Ausstellung über die internationale Ausstrahlung der Düsseldorfer Kunst im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Gezeigt werden rund 400 Ausstellungsstücke, nicht nur Ölgemälde, sondern auch Zeichnungen, Skulpturen und ein Film über die heute weitgehend zerstörten Wandmalereien. Die Ausstellung erinnert daran, dass im 19. Jahrhundert Künstler aus aller Welt nach Düsseldorf kamen, um an der Akademie zu studieren. Einen besonderen Ruf genoss die Akademie in Nordamerika, wozu die deutschstämmigen US-Amerikaner Emanuel Leutze und Albert Bierstadt, die mehrere Jahre in Düsseldorf studiert hatten, viel beigetragen haben. Leutzes Bild „General Washington überquert den Delaware“ gilt als eine Ikone der amerikanischen Geschichte und ist in den USA auch heute noch eines der bekanntesten Gemälde. In der Düsseldorfer Ausstellung ist eine Kopie zu sehen (das Original hängt im Metropolitan Museum in New York und wird nicht ausgeliehen), wobei aus dem Begleittext hervorgeht, dass Leutze das Bild in Düsseldorf gemalt und als Vorlage den Rhein bei Kaiserswerth verwendet hat.
Am meisten überraschten mich die großformatigen Landschaften von Bierstadt, weil sie mir Jahre früher in amerikanischen Museen schon aufgefallen waren und ich mir den Namen des Malers eingeprägt hatte, aber nie seinem Lebenslauf nachgegangen war und nicht wusste, dass er aus Solingen stammte und seine Ausbildung in Düsseldorf erhalten hatte.
(Okt. 2011)
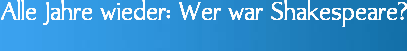
Alle Jahre wieder erscheint ein neues Buch, in dem die Autorenschaft Shakespeares bestritten wird, und inzwischen hat sich ein fester Kreis von Verdächtigen gebildet. All diese Theorien haben zwei gemeinsame Mängel: unzureichende Kenntnis des Werks und der Zeit. Entsprechend sind die Schlussfolgerungen oft abenteuerlich, und der Mangel an Fakten wird durch spekulative Phantasie zu kompensieren versucht.
Zu den üblichen Verdächtigen gehört seit 1920 Edward de Vere. Über ihn ist 2010 im Suhrkamp Verlag ein Buch von Kurt Kreiler mit dem Titel „Der Mann, der Shakespeare erfand“ erschienen. Kreiler hat nach eigenen Angaben fast ein Jahrzehnt mit der Werkanalyse Shakespeares verbracht, zum Sprachvergleich Computerprogramme eingesetzt und ist zum Schluss gekommen, Edward de Vere sei der wahre Autor der Stücke gewesen. Als Beweis führt er den Gebrauch bestimmter Wörter und Wortkombinationen bei de Vere und Shakespeare an, beispielsweise den Ausruf „with hey ho“. Dazu schreibt Kreiler, der „Sommernachtstraum“ ende mit "with hey ho, the wind and the rain" aus dem Regenlied des Narren Feste. Damit liegt er aber nun völlig daneben. Der Sommernachtstraum endet mit einem Gute-Nacht-Wunsch Pucks an die Zuschauer. Das berühmte Regenlied des Narren (das der ausgewiesene Shakespeare-Kenner Harold Bloom in seinem Buch „Shakespeare - The Invention of the Human" als Shakespeares „most wistful song" bezeichnet) bildet hingegen das Ende von „Twelfth Night" (Was ihr wollt).
Hier drängt sich der Verdacht auf, dass weder der Autor noch sein Lektor bei Suhrkamp jemals den Sommernachtstraum gesehen oder sich sonstwie ernsthaft mit den einzelnen Stücken auseinandergesetzt haben. (Dass der Rezensent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Behauptung Kreilers bzgl. des Sommernachtstraum-Schlusses unreflektiert übernahm, kann für den düpierten Suhrkamp-Lektor kaum ein Trost sein. Vielleicht sollten sich Autor, Lektor und Rezensent einmal zum Skat treffen und ihre Shakespeare-Lücken austauschen.)
Jetzt ist von dem Neurologen Bastian Conrad ein verworrenes Buch über Marlowe als Verfasser der Shakespeare-Stücke erschienen. (Wenn Mediziner und Psychiater sich mit kunsthistorischen Spekulationen in fremden Feldern tummeln, ist besondere Vorsicht angebracht. Ein unrühmliches Beispiel lieferte vor 50 Jahren der belgische Psychiater Félix Sluys, der das Werk des spätmanieristischen Malers François de Nomé – der unter dem Notnamen Monsù Desiderio in die Kunstgeschichte eingegangen ist – analysierte und die Hypothese aufstellte, der Maler müsse schizophren gewesen sein, weil er bestimmte Motive und Themen beständig wiederholt hatte. Der Auffassung, die Bildinhalte seien unmittelbarer Ausdruck der Obsessionen des Künstlers gewesen, wurde später widersprochen. Im Katalog der Wiener Ausstellung „Zauber der Medusa – Europäische Manierismen“ wurde die Ansicht plausibel vertreten, de Nomé habe lediglich bewusst bei seinem Käuferpublikum beliebte Themen virtuos variiert.)
Conrad behauptet, dass gleich nach dem Tod Marlowes 1593 die ersten Werke Shakespeares erschienen seien und dass sie auf Anhieb Dichtungen auf der Höhe seines Schaffens gewesen seien. Das sieht Harold Bloom völlig anders: Nach seiner Auffassung sind die ersten Stücke (die verlorene Erstfassung von Hamlet und die drei Teile von Heinrich VI.) zwischen 1588 und 1591 geschrieben worden und waren schon vor Marlowes Tod auf der Bühne. Inhaltlich sowie sprachlich sind diese Stücke schwach, und auch das 1592/93 geschriebene Drama „Richard III.“ weist bezüglich der Charakterisierung der Frauenrollen noch erhebliche Mängel auf – die Höhe seines Schaffens erreichte Shakespeare erst zwischen 1599 und 1606.
Bei der Suche nach dem Mann hinter Shakespeare wird oft die Frage gestellt, ob Shakespeare wirklich Latein, Griechisch usw. sprechen konnte. Natürlich nicht. Es ist bekannt und nachgewiesen, dass er bei all seinen Stücken auf Vorlagen und Quellen zurückgegriffen hat – auch auf Marlowe! Dabei hat er aus Unkenntnis die Fehler seiner Quellen übernommen. So machte er zum Beispiel in „Troilus und Cressida“ aus Cressidas Vater Calchas einen trojanischen Priester, obwohl Kalchas bei Homer der Seher der Griechen war. Die Erklärung ist einfach: Shakespeare griff auf Bearbeitungen einer Geschichte von Chaucer zurück, eine Übersetzung der Ilias ins Englische lag zur Zeit der Entstehung des Stücks noch nicht vor. Auch das Argument, Shakespeare sei nie im Ausland gewesen, ist mit Verlaub lächerlich. Vor 500 Jahren existierten schon zahlreiche europäische Reiseberichte. Bibliographische Hinweise dazu finden sich z. B. bei Lorenzo Camusso: „Reisebuch Europa 1492“, München 1990. Außerdem sei mir der Hinweis auf Karl May und seine präzisen Reisebeschreibungen, ohne vor Ort gewesen zu sein, erlaubt.
Die Vorstellung, Marlowe sei 1593 einfach so von der Londoner Bildfläche verschwunden und habe mindestens bis 1613 (dem Entstehungsjahr von „The Two Noble Kinsmen“), also 20 Jahre lang im Verborgenen gelebt, habe nach dem Tod von Elisabeth I. das Wohlwollen von James I. erworben (Zitat aus S. Greenblatt: „Will in the World“, New York 2004: „The king and his family found his troupe marvelously entertaining. The troupe performed eight plays at court in the winter of 1603-4 …“), ohne jemals aufzutreten oder genannt zu werden, und habe schließlich mit jüngeren Dramatikern wie Middleton zusammengearbeitet, diese Vorstellung erscheint mir absurd. Sie könnte eher aus einem heutigen Thriller oder einem Roman von Lawrence Norfolk oder Neal Stephenson stammen.
(Im Sept. 2011)

Zum Abschluss einer kleinen Kunstreise (Potsdam, Dresden, Leipzig, Altenburg) die Ausstellung „Der Naumburger Meister“ besucht. Von den Stifterfiguren des Naumburger Doms hatte sich bei mir schon vor Jahren das Gesicht Utas tief eingeprägt (es war auf dem Umschlag einer deutschen Ausgabe der 1962 erschienenen "History of Art“ von Horst W. Janson abgebildet). Um die kühle Schöne zu betrachten, bin ich bereits kurz nach der Wende in Naumburg gewesen. Leider an einem trüben Wintertag und im ziemlich dunklen Dom konnte ich von den Gesichtern der erhöht stehenden Stifterfiguren nicht viel erkennen. Bei dem zweiten Besuch an einem Sommertag hatte ich mehr Glück. Die Besucher konnten den Stifterfiguren nicht nur im gut ausgeleuchteten westlichen Domchor ihre Reverenz erweisen, sondern ihnen auch Aug in Aug gegenübertreten: Im kleinen Stadtmuseum am Markt waren Abgüsse aufgestellt, die man aus größter Nähe und von allen Seiten und gespiegelt betrachten konnte. In Augenhöhe mit Uta fiel mir ihre leicht vorgeschobene Unterlippe auf, als wäre sie die Ahnherrin der Habsburger gewesen. Ob sie, wie anlässlich der Ausstellung mehrfach zu lesen war, die schönste Frau des Mittelalters gewesen ist, könnte man lange diskutieren. In der Hoch- und Spätgotik sind viele bemerkenswerte Frauenfiguren erschaffen worden, z. B. die schöne Madonna aus Sankt Johann in Thorn oder die Breslauer Madonna. (Außerdem lassen Zufallsfunde wie das erst vor wenigen Jahren in Aub ausgegrabene gekrönte Haupt einer jugendlichen Heiligen ahnen, welche Kostbarkeiten im Lauf der Jahrhunderte verlorengingen. Die um 1250 geschaffene jugendliche Heilige hat ein fein geschnittenes, bezauberndes Antlitz und trägt eine höfische Frisur, die an die Ecclesia am Bamberger Dom erinnert. Ausgestellt war diese Skulptur zum ersten Mal 2004 in der Landesausstellung "Franken im Mittelalter" in Forchheim.)
Zurück zur Naumburger Ausstellung: Sie war prachtvoll und ein wunderbares Geschenk für die Stadt. Der zweibändige Katalog mit 1500 Seiten erfüllt jede Ansprüche.
(Aug 2011)
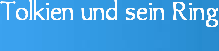
Als ich vor vielen Jahren den Herrn der Ringe las (genauer gesagt im Frühjahr 1975 während eines Skiurlaubs in Klosters in der Schweiz, den ich im abklingenden Stadium einer Halsentzündung angetreten hatte und nicht verschieben wollte, weil das schöne Chalet, in dem ich wohnte, dem Inhaber der amerikanischen Firma, in der ich damals arbeitete, gehörte und man sich etwa zwei Jahre im Voraus, so begehrt war es, anmelden musste und ich bei einem Rücktritt sehr lange auf eine neue Gelegenheit hätte warten müssen, aber dort wegen der Halsentzündung und des nebligen Wetters in der ersten Woche nicht Ski laufen konnte und in einer Buchhandlung ein Exemplar der einbändigen Paperback-Ausgabe aller drei Teile auf 1080 Seiten aus dem Jahr 1968 entdeckte und sofort für 23 Schweizer Franken, in England wären es zwei Pfund zehn gewesen, kaufte – übrigens das einzige Mal, dass ich ein Buch in der Schweiz erworben habe –, weil mir der Buchtitel aus Verlagsanzeigen in amerikanischen SF-Romanen geläufig war, und dann las, nein: in vier oder fünf Tagen verschlang; ehrlicherweise sei aber hinzugefügt: nur die ersten zwei Teile mit den Büchern 1-4 und vom dritten Teil nur den Anfang bis Seite 817, wenigstens steckt dort immer noch ein Lesezeichen, und den Rest habe ich nur durchgeblättert, weil ich natürlich das Ende erfahren wollte, das Wetter sich gebessert und die Halsentzündung vor der Sonne kapituliert hatte; wieder in die Hand genommen habe ich den Roman erst Jahre später, als die Filme ins Kino kamen, um mir die Landkarte von Gondor und Mordor anzusehen, was 1978 bei der Zeichentrickversion von Bakshi noch nicht notwendig war, weil dieser Film vor Beginn des dritten Teils abbrach) , als ich also den Herrn der Ringe las, stellte ich mir damals schon die Frage, in welcher Quelle Tolkien seinen Ring der Macht gefunden hatte.
Aus der Weltliteratur kannte ich nur zwei Ringerzählungen: eine über einen Ring, der den Träger unsichtbar macht, und eine andere über den Ring, mit dem man Gold vermehren kann. Die Geschichte des Rings, der unsichtbar macht, wurde von Plato in „Der Staat“ berichtet, wobei sie ihm als Beweis dafür diente, dass auch ein Gerechter, wenn man ihm volle Handlungsfreiheit gibt, dazu kommt, Böses zu tun. In seiner Erzählung findet ein Hirte in einer Höhle ein ehernes Ross und darin einen Leichnam, der einen Ring am Finger trägt. Der Hirte zieht den Ring ab und merkt zufällig, dass der ihn unsichtbar macht, wenn er ihn dreht. Später tritt er in die Dienste des Königs Kandaules, verführt die Königin zum Ehebruch und tötet gemeinsam mit ihr den König. Eine andere Version, in der kein Ring vorkommt, hatte Herodot fünfzig Jahre früher über König Kandaules, sein Weib und seinen Leibwächter Gyges erzählt (Historien, 1. Buch). In seiner Fassung preist der König die Schönheit seiner Frau und überredet Gyges, sich in seinem Schlafgemach zu verstecken, damit er die Königin am Abend beim Entkleiden beobachten kann. Die Königin bemerkt jedoch seine Anwesenheit und zwingt ihn, Kandaules zu töten. In seinem Drama „Gyges und sein Ring“ hat Hebbel die Erzählstränge gemischt. Er folgte in der Handlung Herodot und fügte von Plato den Ring ein.
Der Ring, der Gold vermehrt, ist der Ring des Zwergenkönigs Andwari (Alberich im Nibelungenlied) aus der Edda. Weitere Fassungen dieses Ringmotivs aus anderen Mythologien und anderen Ländern sind mir nicht bekannt. Nimmt man allerdings an, dass die Edda im achten oder neunten Jahrhundert entstanden ist, könnte ich mir vorstellen, dass ein Skalde einmal mit der Sage von König Midas in Berührung kam und sie für seine Geschichte von Loki und dem Otter umformte.
Bei der Suche nach weiteren Ringerzählungen habe ich abgesehen von dem romantischen Ritterroman „Der Zauberring“ von Friedrich de la Motte Fouqué lange nichts gefunden – weder in Tausendundeiner Nacht noch in europäischen Märchen, wenigstens soweit ich sie gelesen habe – und stieß nur zufällig auf eine Stelle im Talmud, in der erzählt wird, dass König Salomo einen Zauberring besaß, mit dem er Geister zu bannen vermochte.
Äußerungen von Tolkien über die Entstehung von Saurons Ring sind mir nicht bekannt, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Ring, der unsichtbar macht oder der Gold vermehrt, die Vorlage für den einen Ring war, der alle bindet und dem Bösen unterwirft. Vielleicht hat sich Tolkien die Anregung aus dem Talmud geholt. Vielleicht hat sich das Ringmotiv auch schrittweise entwickelt. Dafür spricht, dass in dem frühen Werk „Der Hobbit“ Bilbo Beutlin einen Ring findet, der nur die eine Eigenschaft besitzt, den Träger unsichtbar zu machen.
Leider gibt auch Christopher Tolkien, der literarische Nachlassverwalter seines Vaters, in seinem vor kurzem erschienenen Buch „The Legend of Sigurd and Gudrun“ über die Beschäftigung seines Vaters mit der Edda keinen Hinweis zur Entstehung des Rings.
(Im Juni 2011)
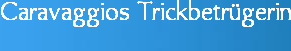
Wer sich zum ersten Mal Caravaggio nähert, bleibt wahrscheinlich bei seinen populären Bildern wie dem Früchtekorb, Bacchus, Christus in Emmaus (Londoner Fassung) oder der Berufung des heiligen Matthäus hängen. Wenn man sich in ihn vertiefen will, lässt man sich dagegen eher von seinen hochdramatischen Kompositionen wie der Grablegung oder den sieben Werken der Barmherzigkeit gefangen nehmen. Vor allem die Grablegung erscheint mir einzigartig, weil man den Eindruck hat, die Figuren seien erstarrt und verharrten wie festgefroren in ihrer Trauer. Bei der Fülle von bemerkenswerten Kompositionen mit faszinierenden Gesichtern wird eine ruhige „einfache“ Komposition wie „Die handlesende Zigeunerin“ leicht in die zweite Reihe der Beachtung abgedrängt. Auch ich hatte mich bislang nie mit ihr näher beschäftigt, sie war für mich eine Genrebild aus der Gruppe „Wahrsagerinnen, Falschspieler und Beutelschneider“, in der die bekannten Gemälde von Georges de la Tour das Maß aller Dinge waren und für mich immer noch sind.
Umso bemerkenswerter fand ich einen Betrag in der FAZ von Jürgen Müller mit feinen Beobachtungen und Entdeckungen.
Z. B. zur Lichtregie des Bildes: Bei Carravagios Gemälden kommt (wie in der Malerei üblich) das Licht meistens eindeutig von links, beim Lautenspieler, bei Martha tadelt Magdalena, bei Amor vincit omnia, bei Christus in Emmaus, bei Judith enthauptet Holofernes, beim Medusenhaupt oder bei David mit dem Haupt Goliaths (Fassung Rom). Ab und zu aber auch von rechts: bei der heiligen Katharina mit dem Rad oder bei der Berufung des heiligen Matthäus. Dass in dem Bild der handlesenden Zigeunerin das von links einfallende Licht rechts heller wird und dass der Blick des Betrachters durch den Verlauf der Helligkeitswerte vom Ärmel des Mädchens auf das Gesicht des jungen Mannes und dann wieder fast kreisförmig zurück gelenkt wird, entgeht einem bei flüchtiger Betrachtung.
Z. B. zum Betrug: Dass das Mädchen dem jungen Mann einen Ring vom Finger zieht, während sie im Blickkontakt mit ihm bleibt, ist für den Betrachter nicht zu erkennen (obwohl das Motiv einem gebildeten Zeitgenossen und den Kreisen, die als Käufer des Bildes in Frage kamen, hätte geläufig sein müssen, schließlich hat es schon Bosch verwendet).
Z. B. und vor allem bezüglich der Ähnlichkeit der Gesichtszüge: Dass es sich zweimal um dasselbe Gesicht handelt, ist eine außerordentliche Entdeckung.
Bedauerlich war lediglich, dass Müller auf einen Vergleich des Bildes im Louvre mit der Fassung, die in Rom hängt, verzichtet hat. Die Unterschiede sind beträchtlich: Die Raffinesse der Lichtregie fehlt, der Degengriff ragt nicht prominent ins Bild, vor allem aber hat der junge Mann andere Gesichtszüge: Sie sind härter, fragender, fordernder (während in der Louvre-Fassung der Blick weicher, naiver und erwartungsvoller ist), und durch eine andere Drehung, bzw. Neigung des Kopfes wird eine Spiegelung der Gesichter verhindert, die Verdoppelung der Identität kann nicht angenommen werden.
Übrigens existieren recht unterschiedliche Meinungen zu der Fassung in Rom: Während es die einen für eine Werkstattarbeit halten, sind andere der Auffassung, diese Fassung sei vor dem Bild gemalt worden, das heute im Louvre hängt. Vor zehn Jahren gab es in der Royal Academy of Arts in London eine Ausstellung zur Geburt des Barock unter dem Titel „The Genius of Rome 1592-1623“. Im Katalog wurde die Bedeutung der handlesenden Zigeunerin besonders hervorgehoben: Das Bild habe durch die Darstellung von Halbfiguren und die Verwendung kontrastierender Farben ein neues Genre begründet. Außerdem wurde auf den gesellschaftlichen Hintergrund der Entstehungszeit hingewiesen: Rom galt als ein Paradies der Schwindler. Das Motiv für das Bild war auf den Straßen der Stadt zu finden.
Zur Entstehung des Bildes findet man in der Lebensbeschreibung des Künstlers von Giovanni Pietro Bellori aus dem Jahr 1672 folgende Anekdote: „Als man Caravaggio einmal die berühmtesten Bildwerke des Phidias und des Glykon zeigte, auf dass er von ihnen lerne, deutete er als einzige Antwort auf die Menschenmenge und bemerkte, dass die Natur ihn zur Genüge mit Meistern versehen hatte. Sein Behauptung zu bekräftigen, rief er eine zufällig vorübergehende Zigeunerin heran, und nachdem er sie in eine Herberge geführt hatte, malte er sie, wie sie nach Art dieser Weiber von ägyptischem Blut die Zukunft voraussagte. Er machte einen Jüngling, der die eine Hand mit dem Handschuh an den Degen legt und die andere entblößt dem Weibe hinstreckt, welche sie hält und betrachtet. Und diese beiden Halbfiguren hat Michele so vollkommene Lebenswahrheit verliehen, dass sie seine Rede bewahrheiteten."
Jürgen Müller war allerdings der Auffassung, Bellori habe Caravaggio mit der Brille des Klassizismus angeschau tund die zu den Bildthemen passenden Anekdoten erfunden. Quoi que ce soit...
(April 2011)

Nach dem großen Verkaufserfolg des 2004 erschienenen historischen Romans „Die Wanderhure“ des Autorenpaares Ingrid Klocke und Elmar Wohlrath wurde der Stoff vom Fernsehen aufgegriffen und im Oktober 2010 ausgestrahlt. In einer Vorabbesprechung kritisierte Jochen Hieber in der FAZ zu Recht die klischeehafte Handlung, ein unrealistisches Bild des Mittelalters und den saloppen, unzeitgemäßen Umgang mit der Sprache. In sprachlicher Hinsicht ist der Roman tatsächlich erschütternd schlecht. An einer Stelle z. B. denkt der Vater der Hauptfigur darüber nach, ob seine Tochter Marie sich schon für einen Mann „interessieren“ könne. Kein Mensch des frühen 15. Jahrhunderts konnte das Wort „interessieren“ denken, weil dieses Verb erst zwei Jahrhunderte später in Gebrauch kam.
Leider verlässt J. H. sein kritisches Urteilsvermögen bei der Beschreibung von Maries Bekleidung. Zum Charakter passe, dass sie von Anfang an blaue Röcke, Kleider und Umhänge trage, dass dieses Blau im Lauf des Geschehens immer dunkler und immer eindringlicher ins Bild gerückt werde. Die Beschreibung gipfelt in der Apotheose: „Blau, als Farbe der Reinheit die Farbe der Jungfrau Maria, gebührt auch der gestandenen, mehr aber noch der gefallenen Bürgerstochter Marie Schärer.“
Das ist leider ganz falsch. Blau war im Mittelalter ein seltener und teurer Farbstoff (er musste aus dem Halbedelstein Lapislazuli gewonnen werden), der meiner Kenntnis nach in jener Zeit nie in größeren Mengen zum Färben von Wolle oder Leinen verwendet wurde. In den Gemälden der Spätgotik und Frührenaissance wurde Blau wegen der Kosten sehr sparsam eingesetzt und war meistens (lassen wir die Buchmalerei einmal außen vor) den Gewändern der Jungfrau Maria sowie ausgewählten Heiligen und Engeln vorbehalten.
Wie die Bürger einer deutschen Stadt tatsächlich bekleidet waren, zeigen beispielhaft die vier Augsburger Monatsbilder. Über diese monumentalen Gemälde aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat der Hirmer Verlag 1994 eine schöne Buchausgabe mit dem Titel „Kurzweil viel ohn’ Maß und Ziel“ herausgebracht. Darin (bzw. auf den Gemälden) wird man aber keine einzige Frau in einem blauen Kleid finden.
In allen Städten gab es strenge Bekleidungsvorschriften, um Stand und Herkunft des Trägers kenntlich zu machen. Während das reiche Bürgertum sich über diese Vorschriften mitunter hinwegsetzen konnte, wurde auf die Einhaltung bei Huren, Bettlern und anderen Ausgestoßenen drakonisch geachtet. Eine Hure in einem blauen Gewand, der Farbe der Muttergottes, wäre eine ungeheuerliche Blasphemie gewesen – über die sich nur mit keinen Geschichtskenntnissen belastete Filmausstatter und Autoren unseres Zeitalters hinwegsetzen können.
(Okt. 2010)
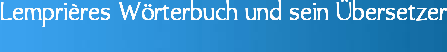
Im Herbst 1992 erschien in der „Zeit“ eine Besprechung des Romans „Lemprières Wörterbuch“ von Lawrence Norfolk. Die Besprechung war ein Verriss, aber der Roman versprach ein labyrinthisches Lesevergnügen, wie ich es liebe, und daher kaufte ich den Roman. Ich begann sofort zu lesen, kam aber über die ersten beiden Seiten nicht hinaus – ich fand keinen Zugang. Ein halbes Jahr später kaufte ich mir in England das englische Original, kam aber auch bei ihm über die beiden ersten Seiten nicht hinaus. Danach blieb das Buch lange im Regal liegen, bis ich im Herbst 2009 den Roman langsam und sorgfältig gelesen habe.
Der Roman handelt von John Lemprière, der im Jahr 1788 in London ein Wörterbuch über Namen der Antike schreibt und in eine Intrige gerät, die ihn in Lebensgefahr bringt. Dabei geht es um die Ostindiengesellschaft und eine Gruppe französischer Kaufleute, die während der Belagerung von La Rochelle 1627 durch die katholischen Truppen aus der Stadt fliehen konnten und die heimlichen Eigentümer der Ostindiengesellschaft sind. Der Roman pendelt zeitlich zwischen diesen Jahren und räumlich zwischen London, Jersey, La Rochelle, Paris und dem Mittelmeer. Also … er ist wirklich sehr verwickelt/verworren. Dazu kommt noch, dass John Lemprière tatsächlich gelebt und dieses Wörterbuch verfasst hat, das auch noch heute immer wieder gedruckt wird – die letzte mir bekannte Ausgabe erschien 2007.
Vergleicht man die deutsche Ausgabe des Romans von 1992 mit dem englischen Original aus dem Jahr 1991, fallen einige große Unterschiede auf. Die deutsche Fassung enthält nicht nur beschreibende Kapitelzusammenfassungen (wie im Dekameron von Boccaccio oder im Blauen Kammerherrn von Niebelschütz), sondern auch ein langes Nachwort mit vielen geschichtlichen Erläuterungen, die im engl. Original fehlen.
Nach Beendigung der Lektüre schrieb ich dem Übersetzer Hanswilhelm Haefs einen Brief, um ihm meinen Respekt für die Übersetzung dieses schwierigen Textes auszusprechen. Schwierig wegen des Vokabulars und wegen der langen Sätze, bei denen man oft nicht weiß, auf wen das jeweilige Personalpronomen Bezug nimmt, ob die Konstruktion grammatikalisch überhaupt möglich oder ob der Satz unvollständig endet.
Dann fuhr ich fort: „Was mein Urteil über den Romans betrifft, bin ich recht zwiegespalten. Einerseits hält der Plot im Verlauf der Handlung leider nicht, was er am Anfang verspricht. Er ist überkonstruiert, enthält zu viele heterogene Phantastik-Elemente (weniger wäre hier wirklich mehr gewesen) und Handlungsstränge, die ins Leere laufen. Reduziert man das Handlungslabyrinth auf den Kern, nämlich darauf, dass Francois John überreden will, der Gruppe beizutreten, oder ihn im Verweigerungsfall umbringen will, dann hätte er das einfacher haben können. Die Beziehungen innerhalb der Gruppe der Acht bleiben völlig unklar. Offensichtlich beabsichtigte Casterleigh entgegen den Anweisungen von Francois schon seit längerem, John zu beseitigen. Warum wartet er mit seinem Versuch, bis sie sich auf dem Theaterdach begegnen? Wer hat aus Le Mara einen Roboter gemacht? Warum begleitet Juliette Jacques nach Paris? Wie haben die acht Männer, die mindestens 210 Jahre alt sein müssen, ihre Langlebigkeit in der Öffentlichkeit vertuscht? Zum Beispiel oder vor allem Casterleigh auf Jersey? (Laut einem Hinweis auf S. 57 der deutschen Ausgabe von 1992 ist sein Haus fünfzig Jahre alt.) Welchem Umstand verdanken die Acht ihre Langlebigkeit? Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Norfolk sich selbst mitunter in seinem Labyrinth verirrt hat – oder er hat die Erklärungen in irgendwelchen dunklen Winkeln und Sackgassen versteckt, die man erst beim zweiten oder dritten Lesen entdeckt. Die Beladung der Vendragon ähnelt einem Hitchcockschen MacGuffin, einem Spannungsele-ment ohne Inhalt, denn dass eine Gruppe von acht Personen ernsthaft glaubt, ein Land wie Frankreich kaufen und die Fäden in der Hand halten zu können, kann man dem Leser eigentlich nicht zumuten.
Andererseits machen die verschachtelten langen labyrinthischen Sätze den Roman zu einem Kunstwerk. Wer schreibt heute solche Sätze? (Nicht vereinzelt eingestreut wie bei Thomas Mann im Zauberberg, sondern als durchgehendes Stilmittel.) Wer würde es wagen, solche Sätze einem Verlag anzubieten bzw. den Lesern vorzusetzen? Entlarvend ist in diesem Zusammenhang der erste Satz des Anhangs über das Manuskript, das seine Rundreise zu den Verlegern machte. In Deutschland hätte ein Newcomer mit solchen Sätzen keine Chancen, verlegt zu werden.
Der Anhang der deutschen Ausgabe ist eine große Bereicherung gegenüber der englischen Originalausgabe und enthält viele überraschende Feststellungen. Wer kennt z. B. die Namen der Hunde Aktaions, wer hat schon mal vom Bruder Henry Fieldings gehört, und wer weiß schon, dass in den Aufzeichnungen des Doomsday Books die Abtei von Abingdon als der größte Landbesitzer nach der Krone geführt wird!“
Zu meiner großen Überraschung erhielt ich einige Wochen später eine Antwort des Übersetzers mit dem Hinweis, meine Fragen zu den Widersprüchen im Handlungsverlauf könne er auch nicht beantworten, die habe bisher noch niemand gestellt. Daraus entwickelte sich ein Briefwechsel, und im Frühjahr 2010 habe ich ihn besucht. Er ist 75 Jahre alt, lebt in einer aufgelassenen Schule in einem kleinen Dorf hinter der Grenze in Belgien und hat seine Bibliothek von, wie er sagte, etwa 30.000 Büchern in zwei ehemaligen Klassenzimmern untergebracht. Bei meinem Besuch erzählte er mir auch vom sogenannten Übersetzerstreit, in dem ihm elf deutsche Übersetzer in einem offenen Brief Unkenntnis der englischen und der deutschen Sprache vorgeworfen hatten. Die Angriffe hatten ihn so mitgenommen, dass er einen Gedächtnisverlust erlitt und seinen Beruf aufgeben musste. Sein Wissen, seine weitgespannten Interessen und seine Publikationen haben mich sehr beeindruckt.
(Im Mai 2010)

Im Sept. 2009 erschien in der FAZ unter der Überschrift „Das Porträt des Deutschen als Zwerg“ ein Beitrag von Julia Franck zur „Blechtrommel“ von Günter Grass. Ich hätte dem Text einen anderen Titel gegeben, nämlich: „Konstrukte einer Nachgeborenen“.
Als ich den Roman „Die Blechtrommel“ im Herbst 1961 zum ersten und einzigen Mal las, wäre ich im Traum nicht darauf verfallen, Oskars verwickelt-verworrene Erzählungen als das Porträt des Deutschen als Zwerg zu interpretieren. Ich hatte ganz andere Zwergen-Assoziationen: Sobald ich etwas tiefer in die Geschichte eingedrungen war, fielen mir Klein Zaches genannt Zinnober und noch mehr Zwerg Nase ein, und ich fragte mich, wann und wie Oskar das Zauberkraut finden würde, um sein Zwergen-Dasein zu beenden. Aber bedauerlicherweise ist er keiner verwunschenen Mimi begegnet. Als ich die Blechtrommel las, war ich 19, und was mir damals auffiel, war die Mischung aus realistischer und fabulierender-phantastischer Erzählweise, die gegen alle Regeln der nüchternen und trockenen Schreibe der 50er Jahre verstieß (Niebelschütz wurde totgeschwiegen – auf seinen Jahrhundertroman „Der blaue Kammerherr“ wurde ich z. B. erst im Nov. 1980 durch eine Besprechung von E. Klessmann in der FAZ aufmerksam –, und die meist österreichischen Autoren phantastisch-realistischer Geschichten wie Perutz, Tramin usw. waren Randerscheinungen) und erst Jahre später nach der Entdeckung von Bulgakow und Borges sowie den Romanen von Márquez u. a. breite Akzeptanz fand. Was mir noch stärker auffiel, waren ein ungewöhnlicher Satzbau (schon im ersten Kapitel auf S. 15 der Originalausgabe geht es damit los: „Es bewegte sich etwas zwischen den Telegrafenstangen …“) und der ungewöhnliche Einsatz von Adjektiven (z. B. „in schon verausgabter Nacht“). Das war ideenreich und originell, das kannte ich nicht. (Was kannte ich zum Vergleich an „moderner“ Literatur? Die Überprüfung meines damaligen Leseuniversums an Hand der jeweils eingetragenen Jahreszahlen der gekauften Bücher förderte für mich selbst Überraschendes zu Tage: Ich kannte die drei Romane von Kafka, Teile aus dem Ulysses, Romane von Faulkner, Hemingway, Steinbeck und Sinclair Lewis; die Pest und den Fall von Camus, Zazie von Queneau, 1984, Dr. Schiwago sowie einige russische Klassiker, Sonnenfinsternis von Arthur Koestler und den heute leider vergessenen Roman „Am grünen Strand der Spree“ von Hans Scholz.) Was mich an der Blechtrommel zunächst fesselte, war die Geschichte Oskars, aber das Interesse an dem Knaben, der Glas zersingen konnte, wurde im Verlauf des Lesens abgelöst vom Interesse an der Geschichte seiner Mutter. Die fand ich aufwühlend, die schlug mich ihren Bann, und die Szene, in der die Aale mit einem Pferdekopf geangelt werden, brannte sich in mein Gedächtnis ein. Die weitere Handlung mit den Nachkriegserlebnissen (das dritte Buch) kam mir schwächer vor, der Roman zerfiel (nach meiner Erinnerung) immer mehr in unzusammenhängende Episoden. Das Ende begann mich zu langweilen, und ich habe auch keine Erinnerungen daran. Nach der Blechtrommel habe ich „Katz und Maus“ überflogen (die erste Seite ist besonders typisch für den kreativen Umgang von Grass mit der Sprache) und „Hundejahre“ sogleich nach Erscheinen gelesen, aber überhaupt keine Erinnerung mehr an den Inhalt, was für mich ein Zeichen ist, dass dem Roman ein durchgängiger Spannungsbogen fehlte und dass ich mich gelangweilt habe. Fünfzehn Jahre später habe ich den „Butt“ angefangen, aber über die ersten Seiten bin ich nicht hinausgekommen. Damit war für mich das Kapitel Günter Grass abgeschlossen.
Kommen wir nun zu Julia Franck, die durch ihren Roman „Die Mittagsfrau“ bekannt geworden ist. Julia Franck ist Jahrgang 1970 und kam 1978 mit ihren Eltern aus Ostdeutschland in den Westen. Sie kennt also die 50er Jahre nur vom Hörensagen. Bei ihrer Interpretation begibt sie sich leider nicht auf Spurensuche nach literarischen Vorbildern, erinnert aber immerhin an die Wurzeln von Grass in der bildenden Kunst und verweist auf Otto Dix und George Grosz. Bei Dix fällt mir auch sogleich das Bild „Die sieben Todsünden“ ein, in dem der Neid als kleines buckliges Männchen mit Hitlerbärtchen dargestellt ist. Falls Grass das Bild kannte, könnte man sich vorstellen, dass diese Figur als Vorbild für Oskar gedient hat. Dann wäre Oskar mit seiner Trommel ein Wiedergänger Adolf Hitlers. Dazu passt, dass Hitler sich in den frühen Jahren der Bewegung als Trommler bezeichnet hat. Ihren eigenen Fingerzeig verfolgt Franck aber nicht weiter, sondern beschreibt den Roman als eine politische Parabel der Nachkriegszeit. Mit dem weitgehend klischeehaften Überbau, den sie dem Roman und der Zeit übergestülpt hat, kann ich gar nichts anfangen. Ihre Kenntnisse der Nachkriegszeit scheint sie sich in Sekundärliteratur recht oberflächlich zusammengelesen zu haben. Sie schreibt merkwürdige Sätze und stellt fragwürdige Behauptungen auf. Ich werde drei Beispiele herausgreifen.
(1) „Wir können (Oskar M.) nicht in die Unschuld entlassen, sowenig wie uns selbst.“ Ich brauchte mich nach der Lektüre nicht in die Unschuld zu entlassen. Der SS-Staat von Eugen Kogon und das Tagebuch der Anne Frank waren Allgemeingut, der Eichmann-Prozess war im Gang, und Andorra von Max Frisch stand vor der Uraufführung. Wir (ich meine damit meine Generation) kannten die Verbrechen des Nationalsozialismus, wir wussten sehr wohl, welche Schuld unsere Väter auf sich geladen hatten. (Was wir allerdings nicht wussten, war das Ausmaß, in dem sich alte Nationalsozialisten – Richter, Journalisten, Architekten usw. – in die Organe und Institutionen der BRD eingeschlichen und integriert hatten. Auch dass sich Kriegsverbrecher wie Barbie oder Mengele mit Hilfe von westlichen Geheimdiensten und kirchlichen Organisationen nach Südamerika abgesetzt hatten, wussten wir nicht und begann uns erst anlässlich des Eichmann-Prozesses zu dämmern.) Julia Franck stellt die Nachkriegsgeschichte so dar, als sei die Zeit des Dritten Reiches grundsätzlich und überall totgeschwiegen worden, und versteigt sich zu albernen Aussagen wie: „Wenn die deutsche Nachkriegsgesellschaft um Atem rang, musste er nicht faul riechen?“ Das Totschweigen trifft aber nicht zu, das ist eines der Klischees, die etwa ab 68 in die Welt gesetzt wurden. Ich bestreite nicht, dass es in den 50er Jahren erfolgreiche Verdrängungsbemühungen gab, aber im Alltagsleben sah es anders aus: In meinem Gymnasium z. B. führten wir 1961 während des Eichmann-Prozesses oder als seine Folge eine Versammlung der Oberstufe und des Lehrerkollegiums durch, in der wir unseren Lehrern Fragen zu 1933 stellten und wissen wollten, warum sie Hitler nicht verhindert hatten. Die Antworten der Lehrer befriedigten uns nicht. Mein Exemplar von Kogons „SS-Staat“ stammt aus dem Jahre 1959, und in der Straße, in der ich wohnte, lebte seit Jahren eine Jüdin, die den zweiten Weltkrieg überstanden hatte, weil ihr (älterer) Liebhaber sie als seine Tochter ausgegeben und in einem bayerischen Landschulheim untergebracht hatte. Wir kannten alle ihre Geschichte. Schon in meiner Kindheit hatte mir meine Großmutter in unserer Stadt Häuser verschleppter Juden gezeigt und den Platz, an dem die Synagoge gestanden hatte. Bei ihrer Kritik der Nachkriegszeit lässt Julia Franck außerdem den außenpolitischen Druck auf unsere Lebensverhältnisse völlig außer acht. Als die Blechtrommel 1959 erschien, steckte uns der Ungarnaufstand von 56 noch in den Knochen, und Fragen, ob die Russen den Westen angreifen und wie lange die russischen Panzer von der Zonengrenze in Thüringen bis zum Rhein brauchen würden, wurden regelmäßig diskutiert. Das waren die existentiellen Fragen, und sie waren uns wichtiger als eine ständige Beschäftigung mit den Verbrechen der Nazizeit. (In diesem Zusammenhang wäre zu erwähnen, dass 1957 deutlich wurde, dass die Nato sich nicht auf einen konventionellen Landkrieg vorbereitet hatte, vielmehr planten die Amerikaner bei einem russischen Angriff den atomaren Vergeltungsschlag – bei dem Deutschland der Kriegsschauplatz gewesen wäre. Als Adenauer die atomare Umrüstung der jungen Bundeswehr propagierte und seine berühmte abwiegelnde Bemerkung über taktische Atomwaffen machte, schrieben deutsche Atomwissenschaftler ihr „Göttinger Manifest“, woraus die Kampagne „Kampf dem Atomtod“ entstand, die sich später zu den Ostermärschen entwickelte, die sich wiederum in die Proteste gegen die Notstandsgesetze verwandelten.) Gleichzeitig stritt man sich über den richtigen Weg zur Wiedervereinigung, den damals noch alle Parteien wollten – na ja, vielleicht nicht die rheinische CDU und nicht die CSU. Als ich die Blechtrommel las, war die Berliner Mauer gerade gebaut worden, und niemand vermochte zu sagen, ob die Russen weitere Nadelstiche oder Schlimmeres vorbereiteten.
(2) Am Anfang ihres Textes schreibt Julia Franck, der Roman zeige, „in welchem Klima unsere Gesellschaft zum Nationalsozialismus wucherte“. Genau dieses Aufzeigen gelingt Grass aber nicht, denn er konzentriert sich aus (s)einem engen Blickwinkel auf einen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft, ein Viertel in Danzig, in dem überwiegend Handwerker und Händler leben. Die Geschichte des Aufstiegs des Nationalsozialismus in der Weimarer Zeit war aber viel komplexer. Die Unterstützung durchzog alle Gesellschaftsschichten und spaltete sie. Hierzu drei Beispiele: Im Garten des Hauses meiner Großeltern stand ein Fahnenmast, und mein Großvater, der ein glühender Anhänger der Weimarer Republik war, hisste regelmäßig Schwarz-Rot-Gold. Kam aber der Bruder meiner Großmutter zu Besuch, der dem Kaiserreich nachtrauerte, beschimpfte er die Flagge als Schwarz-Rot-Senf und lag damit auf einer Linie mit den Nationalsozialisten, die die Fahne als Spalterflagge verunglimpften. Mein Vater (Jahrgang 1913, Abitur 1932) traf sich nach dem Sommersemester 32 an einem Wochenende mit vier Studienfreunden (darunter einem Juden), um über die Lage des Staates zu diskutieren. Dabei sprachen sie natürlich auch über Hitler. „Wir konnten uns“, erzählte er mir noch vor drei Jahren, „nicht einigen, ob wir ihn fürchten sollten oder ob er nur als das geringere Übel anzusehen sei. Wir waren uns nur darin einig, dass es nicht so weitergehen konnte wie bisher.“ Der Universitätsstadt Heidelberg würde vermutlich niemand das Etikett „Vom Mief des Kleinbürgertums durchzogen“ umhängen. Wirft man aber einen Blick in die Stadtgeschichte, stellt man fest, dass die NSDAP bereits bei den Reichstagswahlen 1930 mit Abstand stärkste Partei wurde und dass sich die Stadt später in der Diskriminierung und Verschleppung von Juden besonders hervortat. Im weiteren Verlauf ihres Textes stellt Julia Franck ihre Anfangsbemerkung über das Klima, in dem unsere Gesellschaft zum Nationalsozialismus wucherte, plötzlich in Frage. Aber ihre Schlussfolgerungen sind nicht nur vage, unverbindlich und schwammig („möglicherweise vom Dünkel … befördert“), sondern auch höchst fragwürdig („jeder war verantwortlich“). War z. B. der mutige Georg Elser verantwortlich? War der jüdische Freund meines Vaters verantwortlich, der nach dem Staatsexamen 1936 seinen Beruf nicht ausüben durfte, stattdessen eine Lehre als Kfz-Schlosser machte und nach der Reichskristallnacht Deutschland verließ, seine Mutter aber nicht davon überzeugen konnte, ihn zu begleiten, und nach seiner Rückkehr 1945 erfahren musste, dass sie umgebracht worden war?
(3) An einer anderen Stelle schreibt sie: „Die Blechtrommel zeigt die Widersprüche von Wahrheiten auf und schafft als Werk zugleich eine eigene, unabhängige, unumstößliche Wahrheit: Diese kündet von der Komplexität und Subjektivität jeder Wahrheit, aber auch von der eines Kunstwerks,“ jetzt folgt noch eine Steigerung, „wie sie kein historisches Werk zur Deutung von Gesellschaft und Geschichte jemals in Anspruch nehmen wollte und könnte.“ Was soll man dazu sagen? Handelt es sich um einen Auszug aus einer Facharbeit Leistungskurs Deutsch, gymnasiale Oberstufe, Klasse 12? Der erste Halbsatz ist nichts weiter als großes Wortgeklingel über den Sachverhalt, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Auffassungen haben. Aber welche unumstößliche Wahrheit erzählt Oskar M., der schon zu Beginn des Romas sagt, er berichte nur Lügengeschichten? Die Wahrheit über den Aufstieg des Nationalsozialismus erzählt er auf jeden Fall nicht. (Bemerkenswerterweise hat Oskar auch über die Reichskristallnacht wenig zu erzählen – er erwähnt sie nach meiner Erinnerung nur beiläufig –, und vom Spielzeughändler Sigismund abgesehen kommen Juden in seinem Danziger Universum nicht vor.) Im zweiten Teil des Zitats behauptet Julia Franck – falls ich sie richtig verstanden habe –, dass alle historischen Werke (und Augenzeugenberichte) – also z. B. von Herodot, Thukydides, Prokop, Gregor von Tours, Las Casas, Gibbon, Stendhal usw. bis zu Anne Frank – der subjektiven Wahrheit eines Kunstwerkes nicht das Wasser reichen können, mit anderen Worten inhaltlich zweitrangig und ästhetisch Kümmerlinge ohne Souveränität in Darstellung und Stoffbeherrschung sind. Welchen Maßstab hat sie verwendet? Mit welchen zeitgenössischen fiktionalen Texten von der unumstößlichen Wahrheit eines großen Kunstwerks hat sie die historischen Werke jeweils verglichen? Darüber würde ich gerne mehr wissen. Ich befürchte, dass sie einen Beweis schuldig bleiben wird.
In weiten Teilen ist der Text von Julia Franck eine Zumutung und führt den Leser in die Irre.
(Okt. 2009)
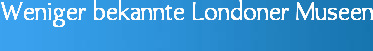
Wer zum ersten Mal nach London reist und etwas Zeit für Museen eingeplant hat, wird vermutlich das British Museum besuchen oder die National Gallery oder die Tate. Bei einem zweiten Besuch wird er je nach Geschmack vielleicht die Tate Modern im stillgelegten Kraftwerk neben dem Globe am südlichen Themseufer oder auch das Victoria and Albert Museum in Knightsbridge südlich vom Hyde Park aufsuchen.
Neben diesen Institutionen bietet London weitere Sehenswürdigkeiten und Museen in Hülle und Fülle an, von denen hier vier kurz vorgestellt seien. Die Wallace Collection am Manchester Square zum Beispiel. Das im 18. Jahrhundert errichtete stattliche Gebäude mit großem, heute überdachtem Innenhof war im 19. Jahrhundert Wohnsitz der Hertford-Familie, diente der Aufnahme der rasch wachsenden Sammlung, wurde später dem Staat gestiftet und im Jahr 1900 als Museum eröffnet. Die Sammlung enthält Gemälde, Waffen, Rüstungen, Porzellan und Möbel vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, wobei das französische Rokoko mit zahlreichen Werken von Boucher und Fragonard den Schwerpunkt bildet. Die Sammlung verteilt sich auf zwei Geschosse, Rüstungen und Waffen werden im Erdgeschoss gezeigt, die Gemälde überwiegend im Obergeschoss mit der beeindruckenden großen Galerie, die sich über die gesamte Länge des Gebäudes hinzieht. Das Museum ist täglich geöffnet, der Eintritt ist frei.
Zu den Spitzenwerken der Wallace Collection gehören „Die Schaukel“ von Fragonard, „Der lachende Kavalier“ von Frans Hals, das „Porträt einer Dame mit Fächer“ von Velázquez und „Titus mit roter Mütze“ von Rembrandt. Das Motiv der Schaukel hat Fragonard im Abstand von zehn Jahren zweimal gemalt. Die erste Fassung, die in London hängt, heißt eigentlich „Die glücklichen Zufälle der Schaukel“, ist wahrscheinlich Fragonards bekanntestes Werk und zum Aushängeschild des französischen Rokokos geworden. Es hat alles, was zu unserer Vorstellung von der Zeit gehört: Leichtigkeit, Lebensfreude, Eleganz, Erotik und Frivolität. Müsste ich einem Fremden das Wesen des Rokokos anhand eines Bildes erklären, würde ich Fragonards Schaukel nehmen. Betrachtet man das Gemälde allerdings näher, fällt einem auf, dass es symbolisch überladen ist. Außerdem ist das Mädchen auf der Schaukel eigentlich keine Schönheit, die Körperproportionen stimmen nicht: Die Oberschenkel sind viel zu lang, da müsste schon Nadja Auermann Modell gesessen haben. Wichtiger aber scheint die Feststellung, dass das Mädchen mit seinen Pausbacken und Knopfaugen etwas dümmlich wirkt. Oder wollte der Maler nur den Augenblick festhalten, in dem dem Mädchen klar wird, welche Einblicke es dem im Gebüsch versteckten Galan gewährt? Vergleichbare Grübeleien braucht man beim lachenden Kavalier und bei der Dame mit Fächer nicht anzustellen. Die Dame mit Fächer gehört zwar zu den nur selten reproduzierten Gemälden von Velázquez, ist aber dank der Intensität der Darstellung und der dunklen Farbpalette ein herausragendes Werk mit dem Geheimnis der Identität der Dargestellten, die bis heute nicht geklärt werden konnte. Vielleicht handelt es sich um die Ehefrau des Malers, vielleicht um seine Tochter. Auch der lachende Kavalier ist abgesehen davon, dass der Titel nicht stimmt, über jeden Zweifel erhaben, maltechnisch ein großes Meisterwerk und seinem Pendant im Reichsmuseum Amsterdam haushoch überlegen.
Um ein Museum ganz anderer Art handelt es sich bei der Courtauld Gallery im Somerset House. Obwohl nach Umfang der ausgestellten Werke viel kleiner als die Wallace Collection, werden die wesentlichen Epochen der Kunstgeschichte von der Gotik bis zur Moderne mit herausragenden Werken abgedeckt. Das liegt daran, dass hier im Lauf der Zeit vier unterschiedliche Privatsammlungen zusammengeführt werden konnten. Zu den Meisterwerken gehören u. a. eine Landschaft mit der Flucht nach Ägypten von Pieter Brueghel, ein Familienbildnis von Rubens, ein Porträt der Lady Greville von Romney, die Theaterloge von Renoir, das Mädchen in der Bar Aux Folies-Bergère von Manet, die Kartenspieler und der See von Annecy von Cézanne. Das Somerset House liegt am Embankment-Ufer neben der Waterloo-Brücke. Das Museum ist täglich geöffnet.
Südöstlich vom Zentrum und schon außerhalb des U-Bahn-Netzes liegt in einem ruhigen Vorort die Dulwich Picture Gallery. Sie wurde 1814 in einem extra für sie errichteten neoklassizistischen Bau eröffnet und ist damit das älteste für Publikum zugängliche Museum Englands. Den Grundstock der Galerie bildete eine Gemäldesammlung für einen polnischen König, der die Sammlung aber nie erhalten hat, weil er vorzeitig abdanken musste. Gezeigt werden Gemälde des 17. Und 18. Jahrhunderts, darunter Bilder von Claude Lorrain, Poussin, Rembrandt, Van Dyck, Canaletto, Gainsborough und Reynolds. Man erreicht das Museum mit dem Zug und fährt entweder von der Victoria Station nach West Dulwich oder von London Bridge nach North Dulwich. Von beiden Stationen liegt das Museum etwa zehn Gehminuten entfernt.
Einhundert Jahre vor dem Bau der Dulwich Gallery wurde in einer ganz anderen Ecke Londons, westlich vom Zentrum das Chiswick House nach dem Vorbild der Villa Rotonda in Vicenza errichtet. Damit ist es eines der ältesten und schönsten Beispiele des palladianischen Stils in England. Chiswick House ist außerdem für seine Sammlung klassischer Statuen und für den Park berühmt, der als wichtiges Beispiel englischer Gartenarchitektur des frühen 18. Jahrhunderts gilt. Bei der Gestaltung formulierte der Architekt William Kent zum ersten Mal die Regeln des englischen Landschaftsgartens mit schönen Ausblicken, sich schlängelnden Wegen, künstlichen Ruinen und antiken Tempeln als Kontrast zum strengen französischen Barockgarten.
Haus und Park sind von April bis September täglich geöffnet, in den Wintermonaten aber nur eingeschränkt zugänglich. Da die nächste U-Bahn-Station Turnham Green ziemlich weit entfernt ist, nimmt man besser ab Hammersmith den Bus. Wer aber schon so weit gekommen ist, könnte die Gelegenheit nutzen und anschließend Kew Gardens in Richmond besuchen.
(Im Sept. 2009)
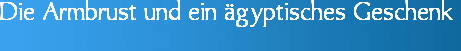
Der Tag in New York hatte mit einem Besuch des Klosters, der Zweigstelle des Metropolitan Museums für mittelalterliche Kunst am Steilufer des Hudsons, gut angefangen. Zumal ich zum ersten Mal den Mérode-Altar im Original sehen konnte.
Nachmittags schloss ich mich bei einem Besuch des Metropolitan am Central Park einer Führung an – hauptsächlich aus Neugier, um zu sehen, welche Gemälde der Führer zur Besprechung auswählen würde und ob eins meiner fünf Lieblingsbilder („Ansicht von Toledo bei Gewitter“ und der „Großinquisitor“ von El Greco, die „Weizenfelder“ von Jacob van Ruisdael, „Selbstbildnis vor dem Fenster“ von Marie-Denise Villers und „Mme Ginoux“ von van Gogh) darunter wäre.
Der Führer, ein Deutscher, der nach seiner Vorstellung seit mehreren Jahren im Metropolitan arbeitete und den Vierzig näher als den Dreißig war, eröffnete seinen Rundgang vor einer Skulptur aus Mesopotamien und sprach anschließend über einen römischen Cäsarenkopf. Danach ging er mit uns durch das halbe Museum, bis wir einen Saal mit mittelalterlichen Waffen und Rüstungen erreichten. Dort zog er uns in eine Ecke und zeigte uns eine Armbrust. In der nächsten halben Stunde redete er ausschließlich über diese Waffe. Er berichtete, dass sie im Jahr 1460 gefertigt worden war, dem Herzog Ulrich V. von Württemberg gehört und in welcher Schlacht der Herzog sie benutzt hatte. Er berichtete, wer die Armbrust hergestellt hatte, ein Heinrich Heid aus Winterthur, der, was der Name vermuten lässt, wahrscheinlich ein Jude gewesen war. Er berichtete, aus welchem Holz der Bogen bestand und welche Legierungen verwendet worden waren. Wie man die Pfeile einlegte, wie man sie spannte und aus welchem Material die Sehne gefertigt wurde. Woraus die Pfeile bestanden hatten, welche Reichweite und welche Durchschlagskraft sie besaßen. Er wusste alles über diese Armbrust und erzählte uns alle Einzelheiten. Abschließend bemerkte er, über diese Armbrust schreibe er seine Doktorarbeit.
Dann sah auf seine Uhr und sagte, jetzt müssten wir uns aber sputen. Fast im Laufschritt verließen wir den Saal und wurden zum nördlichen Anbau des Museums mit dem Tempel von Dendur gebracht. Dendur war ein Ort südlich von Assuan am Ufer des Nils. Hier stand ein kleiner Tempel aus römischer Zeit, den der römischen Statthalter Petronius im Namen des Kaisers Augustus hatte errichten lassen. Wie Abu Simbel wäre der Tempel von Dendur nach Vollendung des Assuan-Staudamms in den Fluten des Stausees versunken. Um Abu Simbel zu retten, wurde die Tempelanlage aus dem Fels gesägt und an einen höheren Ort versetzt. Als Dank für den Beitrag der Amerikaner zu dieser Rettungsaktion schenkte die ägyptische Regierung den Vereinigten Staaten den Tempel von Dendur. Vor der Flutung wurde er abgebaut, nach Amerika verschifft und 1978 im Metropolitan wieder aufgebaut. An die Rettung von Abu Simbel erinnerte ich mich gut – die Presse hatte im Lauf der Jahre ausführlich erst über den Plan und dann über die Ausführung berichtet. Von Dendur dagegen hatte ich noch nie gehört. Nachdem unser Führer seine Erläuterungen zu dieser Geschichte und zu Einzelheiten der Anlage abgeschlossen hatte (allerdings ohne irgendetwas über die ökologischen Folgen des Staudamms zu sagen, u. a. die starke Verdunstung und Versalzung des Wassers), verabschiedete er sich und ging schnellen Schrittes davon. Über die Gemälde des Museums hatte er während seiner Führung kein einziges Wort fallengelassen, auch zum Abschluss gab er keine Empfehlungen und nicht einmal einen Hinweis auf eine Poussin-Sonderausstellung.
Obwohl ich vorgehabt hatte, nach der Führung noch einige Zeit in den Sälen mit europäischer Malerei zu verbringen, verließ ich das Metropolitan, überquerte die Straße und ging zur Frick Collection, einem Museum, das mich immer an die Londoner Wallace Collection erinnert. Dort wurde ich von einer kleinen Sonderausstellung über Parmigianinos Gemälde „Antea“ überrascht, das normalerweise in Neapel hängt, aber vor Jahren in einer Bonner Ausstellung über das Nationalmuseum in Neapel zu sehen war. Das Bild zeigt eine stehende junge Frau, die sehr elegant gekleidet ist und den Betrachter offen anblickt. Man weiß immer noch nicht, wen die junge Frau darstellt und vermutet in Antea entweder eine Geliebte des Malers oder eine idealisierte Schönheit.
Parmigianino gehört auch zu den „Problemfällen“ für mein imaginäres Museum, da man ihn mindestens mit zwei Gemälden würdigen müsste: mit seinem „Selbstporträt im Konvexspiegel“ und mit der „Madonna mit dem langen Hals“. Aber auch mit einem zusätzlichen dritten Bild, z. B. dem „Selbstporträt mit roter Mütze“, das kurz vor seinem Tod entstand, wäre er nicht überbewertet.
(Mai 2008)

Symbolistische Malerei war einer der Begriffe, die meiner Erinnerung nach im Kunstunterricht auf dem Gymnasium nie erwähnt worden sind. Allerdings muss man um der Gerechtigkeit willen hier einräumen, dass der Begriff Symbolismus auch in Monographien der 50er Jahre nicht oder höchstens als Fußnote enthalten war. Noch dem ab 1965 erschienenen großen Malerei-Lexikon von Kindler war der Begriff gerademal 20 Zeilen wert. (Andererseits enthielt schon 1955 Knaurs Lexikon Moderner Kunst einen mehrseitigen, allerdings hauptsächlich auf Frankreich bezogenen Text über den Symbolismus – ohne Einbezug von Khnopff und Präraffaeliten.)
Als Begriff der Kunstgeschichte fiel mir Symbolismus erst Mitte der 70er Jahre auf, als in der Galerie Schuler mehrere preiswerte Bände zu diesem Thema erschienen, die Übersetzungen italienischer Ausgaben aus den 60er Jahren waren. Originale sah ich Anfang 1976 in der Ausstellung „Symbolismus in Europa“, die in Deutschland in Baden-Baden Station machte und vorher schon in Rotterdam und in Brüssel gelaufen war. Es war eine umfassende Darstellung dieser künstlerischen Strömung mit über 260 Exponaten, wobei Redon, Moreau, Munch, Rossetti und Puvis de Chavannes im Mittelpunkt standen. Daneben war alles vertreten, was Rang und Namen hat – von Beardsley und Böcklin über Hodler und Klinger bis Prikker und Toorop. Außerdem viele unbekannte mit Einzelwerken wie z. B. Jozef Mehoffer mit dem Gemälde „Der merkwürdige Garten“, in dem in einem blühenden Garten eine riesige Libelle drei Menschen zu bedrohen scheint.
Die Ausstellung hatte große Resonanz beim Publikum und in der Presse. So berichtete Petra Kipphoff in der Zeit unter dem Titel „Die Kunst der schönen bösen Träume“ verwundert, dass sich die Besucher um Bilder drängten, deren anachronistische Symbolik sie nur verstehen könnten, wenn sie über ein umfassendes mythologisches und historisches Bildungsgut verfügten (das sie aber nicht hätten). Danach folgte aber gleich die bemerkenswerte Feststellung, der Ausstellungstitel klebe nicht ein nie existent gewesenes Tableau zusammen, sondern zeige, dass der Symbolismus der erste gesamteuropäische Stil gewesen sei. Quer durch Geographie und Kunstgattungen sei aus der Ablehnung der Zeit ein Gesamtkunstwerk entstanden, zu dem nicht nur die Maler, sondern auch die Literaten und Komponisten ihren Teil beigesteuert hätten. Leider jedoch hätten sie sich einer besonderen Obsession hingegeben: der Frau und ihrer Rolle als Femme fatale, sei es als Sphinx, Eva, Judith, Salome, Venus, Medusa, Undine, Loreley oder Vamp.
Auch stern, Spiegel und FAZ berichteten ausführlich über die Ausstellung. Unter dem Titel „Andachtsbilder für die Salons“ schrieb Wilfried Wigand in der FAZ, die betäubende Vielfalt zeige, dass der Symbolismus um 1880 eine wahrhaft europäische Bewegung gewesen sei. Zusammengehalten von der Abneigung gegen die Fortschrittsgläubigkeit und den als banal empfundenen Impressionismus. Von Munch stammt das sogenannte Manifest von Saint Cloud, in dem unter anderem gefordert wurde, keine Interieurs, keine lesenden Menschen und keine strickenden Frauen mehr zu malen, sondern Menschen, die fühlen, lieben und leiden. Im weiteren Text stellt Wigand die Frage nach den Vorläufern und Ahnherren des Symbolismus, kommt auf Blake, Friedrich und Goya und zu dem Schluss, dass der Anerkennung des Symbolismus immer noch das Denkschema im Wege stünde, die Geschichte der modernen Kunst sei eine Geschichte des Fortschritts vom Realismus über den Impressionismus zur Abstraktion.
Jetzt (30 Jahre später) wurde in Wien unter dem Titel „Der Kuss der Sphinx“ eine Ausstellung speziell über den Symbolismus in Belgien gezeigt und Brüssel als Drehscheibe des Symbolismus in Europa beschrieben. Im Zentrum standen die Werke von Fernand Khnopff, Felicien Rops, Jean Delville und dem wenig bekannten Xavier Mellery.
(März 2008)

Das Tauwetter nach dem Zusammenbruch der UdSSR bescherte der Stadt Essen im Jahr 1993 eine großartige, einzigarte Ausstellung französischer Kunst der klassischen Moderne aus russischen Sammlungen. 120 Gemälde aus dem Puschkin-Museum Moskau und der Eremitage in St. Petersburg von 24 Malern, von Bonnard über Denis, Gauguin, Gogh, Matisse bis Picasso, Renoir und Signac waren vier Monate lang im Museum Folkwang zu sehen. Die Werke zusammengetragen hatten die russischen Textilkaufleute I. Morosow und S. Schtschukin auf mehreren Parisreisen in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Zum Glück für die Breite der Sammlungen hatten Morosow und Schtschukin unterschiedliche Vorlieben. Der erstere bevorzugte Cézanne, Renoir und Bonnard, der letzere Matisse und Picasso. Aufbewahrt wurden die Gemälde zunächst in den Moskauer Stadtpalais der Sammler und waren für Publikum nur eingeschränkt zugänglich. Nach der russischen Revolution wurden die Sammlungen enteignet, die Bilder wanderten in ein neues Museum für Neue Westliche Kunst und wurden erst nach dessen Schließung 1948 zwischen dem Puschkin-Museum und der Eremitage aufgeteilt.
Diese Geschichte der Sammlungen und ihre Wirkung auf die russische Malerei waren im Westen bis jetzt so gut wie unbekannt. Ermöglicht wurde die Essener Ausstellung von der Ruhrgas AG anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums der russischen Erdgaslieferungen.
Besonders beindruckt haben mich „Das rote Zimmer“ von Henri Matisse, „Die Pinie von Bertaud“ von Paul Signac und „Figuren in Frühlingslandschaft“ von Maurice Denis.
Jetzt (15 Jahre später) zeigt der Kunstpalast Düsseldorf unter dem Titel „Bonjour Russland“ eine ähnliche Ausstellung. Nein, das ist nicht ganz richtig: Die Düsseldorfer Präsentation besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird (in Wiederholung der Essener Ausstellung) eine Auswahl der Sammlungen von Morosow und Schtschukin gezeigt, im zweiten Teil zusätzlich Gemälde russischer Künstler aus der Zeit von 1870 bis 1925. Der erste Teil enthält 50 Kunstwerke, von denen knapp die Hälfte schon in Essen zu sehen war, z. B. „Jeanne Samary“ von Auguste Renoir, drei Landschaften von Paul Cézanne und „Doktor Rey“ von Vincent van Gogh. Auch „Das rote Zimmer“ wurde wieder auf die Reise geschickt. Zu den schönsten Exemplaren der neuen Zusammenstellung gehört ein Bild von Renoir mit dem Titel „Im Garten von Galette“, das ein Motiv aus dem zu Recht berühmten „Tanz in der Mühle von Galette“ aus dem Musée d’Orsay aufgenommen hat. Dort sieht man im Vordergrund eine junge Frau in einem weißblau gestreiften Kleid, die sich mit anderen Gästen unterhält. In der kleineren Fassung sieht man diese Frau von hinten – sie scheint gerade eingetroffen zu sein, hält noch einen Sonnenschirm in der der Hand und nimmt sich mit der anderen Hand ihren Hut ab. Die Flüchtigkeit des Augenblicks ist wunderbar getroffen.
Der zweite Teil enthält rund 70 Gemälde, die dem Besucher einen guten Überblick über die Rezeption der westlichen Avantgarde durch russische Künstler gewähren. Chagall ist mit zwei Bildern vertreten und Kandinsky mit drei, darunter der großen Komposition VII aus dem Jahr 1913. Es wäre übertrieben, alle anderen ausgewählten Gemälde als Meisterwerke einzustufen, aber einige sind doch von überragender Qualität. Zum Beispiel das Bildnis „Sofia Botkina im gelben Kleid“ von Valentin Serov aus dem Jahr 1899. Seine Farbgebung ist raffiniert, die Gelbtöne kontrastiert er mit dunklem Blau und Schwarz. Das Porträt könnte als ein Werk des Fin de Siècle durchgehen und hätte von Giovanni Boldini gemalt sein können. Serov ist mit einem weiteren bemerkenswerten Bild vertreten, dem 1910 gemalten Rückenakt „Ida Rubinstein“, der magere Körper mit seinen schwarzen Begrenzungslinien scheint die Hungerakte Bernard Buffets vorwegzunehmen. Den Höhepunkt der Ausstellung bildete für mich ein weiteres Frauenporträt, das 1915 von Natan Altman gemalte „Bildnis der Anna Achmatova“. Sie trägt ein blaues, ins Violette übergehendes Kleid, das mit einem in leuchtendem Gelb gehaltenen Tuch kontrastiert wird, während eine unbestimmte kubistisch-abstrakte Landschaft in blassen Farben den Hintergrund bildet. (Man könnte meinen, dieses Bild sei Altmans Antwort auf Serovs Porträt.)
Während der Katalog der Essener Ausstellung mit einem Grußwort des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl eingeleitet wurde, haben für die Düsseldorfer Ausstellung Angela Merkel und Vladimir Putin Grußworte geschrieben. Aber wie sich das politische Klima gewandelt hat und wieder kulturelle Eiszeit zwischen Großbritannien und Russland herrscht, kann man daran erkennen, dass die geplante Fortsetzung der Ausstellung in London, die für 2008 vorgesehen war, von Moskau verboten wurde.
(Im Januar 2008)

Einige Wochen nach dem Besuch der Patinir-Ausstellung in Madrid las ich in einer Zeitung eine kurze Abhandlung über Museumsbesucher. Man hätte erwarten können, dass die Autorin mit einer Stellungnahme zu Adornos herablassender Vernichtung, Museen seien die Gräber für Kunstwerke, beginnen würde. Die aus den 50er Jahren stammende Kritik an der bürgerlichen Kulturinstitution des Museums als Ort der Ansammlung toter Objekte ohne Bedeutung für den Betrachter findet sich in dem Text „Valéry Proust Museum“, enthalten in dem Band „Kulturkritik und Gesellschaft I“. Obwohl die Polemik ins Leere läuft und ein Schmarrn ist, ließ sich die Autorin auf eine Auseinandersetzung mit Adorno nicht ein und begann ihren Text stattdessen mit der Beschreibung von Publikumstrauben, die sich bei ihrem Besuch in der Tate Modern in London um einen Glaskasten mit einer Karotte von Joseph Beuys gebildet hatten. Mir sind nun bei bislang drei Besuchen in der Tate Modern diese Trauben mit Karotte nicht aufgefallen. Ehrlich gesagt, ich kann mich an die Karotte von Beuys überhaupt nicht erinnern. Aber da das Gedächtnis ein merkwürdiger Geselle ist, der nach Lust und Laune die Erinnerungen ständig verändert und neu zusammenstellt, wollte ich meinem auf die Sprünge helfen, bin ins Netz gegangen und habe einen virtuellen Rundgang durch das Museum gemacht. Dabei bin ich nur auf ein (anderes) Werk von Beuys gestoßen: „Lightning with Stag in its Glare“ – zu sehen auf Level 3, Poetry and Dream, Raum 6 neben den langweiligen Bildern von Cy Twombly (noch langweiliger kamen mir nur die benachbarten Bilder von Mark Rothko vor). Nachrichten über die Karotte habe ich keine entdeckt. Deswegen hätte ich gerne gewusst, wo sie sich heute befindet. Nein, das stimmt nicht. Es ist mir nicht so wichtig, wo sie hängt, steht oder liegt; ich möchte nur eine Beobachtung festhalten, die ich in verschiedenen Museen gemacht habe, nämlich die, dass sich höchst selten Besucher um Exponate von Beuys drängeln und spitze Schreie der Verzückung ausstoßen; vielmehr scheint es so zu sein, dass Besucher sie meiden. Aufgefallen ist mir dies zum Beispiel in der Pinakothek der Moderne in München, in der ich in den ersten drei Jahren nach der Eröffnung mindestens viermal war. Der gemeine Besucher, der Dilettant, der sich im ursprünglichen Wortsinn an Bildern delektieren will, versammelt sich mit seinesgleichen in den Räumen der klassischen Moderne und meidet die Räume oben rechts von der Treppe. Ich wenigstens habe sie stets leer vorgefunden. Ähnliche Erfahrungen habe ich in Bonn gemacht. Während die Wechselausstellungen der Bundeskunsthalle gut besucht sind, ist der Andrang im benachbarten Haus mit der Sammlung all der Zeitgeistkünstler (Beuys, Baselitz, Kiefer, Polke usw.) höchst bescheiden, und vor Richters Kuh zum Beispiel hatte ich noch nie Gesellschaft. Nun könnte einen ja kaltlassen, dass das Haus wenig Besucher anzieht, wenn nicht die Gesinnung, aus der diese und ähnliche Sammlungen entstanden sind, gleichzeitig dafür gesorgt hätte, dass Thyssen, als er einen Standort in Deutschland suchte, abgewiesen wurde, und dass man heute nach Madrid fliegen muss, um den Mädchenkopf von Juan de Flandes, La Bella von Palma il Vecchio, die hl. Katharina von Caravaggio, Ruisdaels Winterlandschaft, Vuillards Sängerin oder auch Ludwig Meidners Eckhaus zu sehen.
In ihrem Text beschäftigte sich die Autorin mit der Frage, was die Menschen in die Museen treibt. Meine Meinung dazu: Die Menschen gehen dahin, wo die Musik spielt. (1) Die Musik spielt zunächst dort, wo alle hingehen. Beispiel Madrid: Alle strömen in den Prado, dagegen bleibt eine Sammlung wie die Akademie von San Fernando weitgehend unbeachtet, und niemand weckt dort die Aufpasserinnen aus ihrem Schlaf. Dabei könnte ein Besucher Goyas einzigartiges Begräbnis der Sardine bewundern und, wenn er die Augen offenhielte, Magnascos genialische Paraphrase des alten Themas vom hl. Lukas, der die Madonna malt, entdecken. Ähnliche Beobachtungen über unterschiedliche Besucherströme lassen sich auch in N.Y. anstellen: Ist das Moma proppenvoll, kann man ruhige Vormittagsstunden im Metropolitan verbringen. Vor J. Ruisdaels Weizenfeldern bilden sich keine Trauben; die deutschen und japanischen Touristen sind damit beschäftigt, Monets Seerosen anzustaunen und Picassos geschundene Mädels aus Avignon. Nur in London ist es anders: Trotz der Fülle des Angebots werden auch abseits liegende Museen wie z. B. die Dulwich Picture Gallery frequentiert.
Die Menschen gehen dahin, wo die Musik spielt. (2) Die Musik spielt dort, wo Marketingmethoden eingesetzt, Sonderausstellungen als Ereignisse (pardon: Events) aufgezogen und kräftig beworben werden. Auch dagegen ist vom Standpunkt des Besuchers, der zudem für die didaktischen Einführungen dankbar ist, nichts zu einzuwenden, selbst wenn (wie z. B. bei der Melancholie-Ausstellung in Berlin im vergangenen Jahr) unter einem thematischen Gesichtspunkt krampfhaft zusammengehängt wird, was nicht zusammengehört. (Die Bilder hätten gegen ihre Reisen wohl Einwände, da sie aber keine Zunge besitzen, müssen sie schweigen.) Wenn ich die Chance erhalte, das rote Zimmer von Matisse schon wieder vor der Haustür zu sehen (jetzt in Düsseldorf, 1993 gastierte es in Essen), nehme ich die Gelegenheit natürlich wahr. Umgekehrt gilt, dass Museen abseits der Heerstraßen und ohne Sonderausstellungen im Schlaf liegen, verdämmern. Braunschweig ist so ein Beispiel.
(3) Die Musik spielt dort, wo das Ambiente stimmt. Die Museen und ihre Umgebung sind schöner geworden. (Die Zeiten, in denen man Bilder an nackte Betonwände hängte, sind glücklicherweise vorbei. Getty sei Dank!) Der Besucherandrang in der TM zum Beispiel beruht zweifelsfrei zum großen Teil auf der Attraktivität der Umgebung. Das umgestaltete Südufer der Themse westlich der London Bridge mit der Golden Hinde, dem Globe, der Fußgängerbrücke und Restaurants wie der Cantina Vinopolis übt eine große Anziehungskraft zum Flanieren und Verweilen aus. Über deutsche Beispiele wie Baden-Baden oder Dresden brauchen wir hier nicht zu reden.
In ihrem Text streifte die Autorin auch das Thema des Kunsthandels. Ich vermute, dass der normale Museumsbesucher nicht den Markt im Blick hat und kein Kunstkäufer ist. Ob der Kunstkäufer ins Museum geht, weiß ich nicht. Vielleicht um seinen Geschmack zu schulen, vielleicht auch, um – falls er über das große Geld verfügt – Entdeckungen zu machen. In den Wechselausstellungen tauchen immer wieder unbekannte Bilder aus Privatsammlungen auf. So hing z. B. in der Patinir-Ausstellung ein großes Triptychon aus einer Schweizer Privatsammlung, das ich, obwohl ich glaubte, mit Patinirs Werk vertraut zu sein, vorher noch nie gesehen hatte.
Was Besucherinnen angeht, kann ich der Autorin beipflichten. Nach dem Augenschein besuchen mehr Frauen als Männer Kunstausstellungen. Schon bei den Kindern (überwiegend Gruppen oder Schulklassen) fällt auf, dass es die Mädchen sind, die länger vor Bildern verweilen und miteinander darüber reden.
In der Malerei ist es wie in der Literatur: Männer produzieren sie, und Frauen konsumieren sie (was nicht heißen soll, dass sie die Karotte verzehrt haben).
(Nov. 2007)
Unter dem Titel „Gebellte Sprache“ veröffentlichte der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant im September 2007 in einer Tageszeitung einen zornigen Beitrag zur Sprachscham der Deutschen und zur Verwahrlosung unserer Sprache. Zu diesem Text schrieb ich ihm einen ironischen Kommentar mit meinen persönlichen Erfahrungen.
Das Projekt zur Abschaffung der Deutschen Sprache wird von vier Sponsorengruppen getragen und gefördert: Politikern, Industrie-Managern, Professoren und Journalisten. Da sich diese Sponsorengruppen gegenseitig unterstützen, könnte man auch von einem dynamischen System oder sogar von einer Maschine mit vier Antriebsmotoren sprechen. Schmiermittel dieser Maschine sind nicht nur vorgetäuschte Schamgefühle, sondern auch Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, vor allem aber Dummheit. (Diese Maschine erinnert mich an eine andere, die ein eigentümlicher Apparat war und deren ursprünglicher Bauplan schon vor neunzig Jahren in Prag für einen anderen Zweck entworfen wurde. Jener Apparat bestand bekanntlich aus drei Teilen, dem Bett, dem Zeichner und der Egge. Nach dem Bericht eines Reisenden war das Räderwerk der Schwachpunkt der ersten Ausführung und hielt den Belastungen nicht stand. Ich vermute, dass die Sponsorengruppen die Maschine daher umkonstruierten und das Räderwerk, da in Deutschland bekanntlich die Facharbeiter fehlen, im Ausland herstellen ließen. Dank dieser klugen Entscheidung funktioniert die Maschine heute einwandfrei.)
Sie beginnen Ihren Artikel mit der Sprachscham. Das Merkwürdige an dieser Sprachscham ist für mich nicht, dass sie existiert oder besser gesagt, als Vorwand herhalten muss, sondern der Zeitpunkt, an dem sie einsetzte. Sie war nämlich der Generation, die den Krieg überlebte, durchaus nicht eigen. Und Ihrer Behauptung, vor allem die deutschen Wissenschaftler hätten sich beeilt, ihre Publikationen auf Englisch umzustellen, muss ich widersprechen. Noch in den sechziger Jahren war von dieser Beeilung nichts zu bemerken. Die Umstellung begann später, sie wurde von der Generation der Söhne und Enkel eingeleitet. (Ein prägnantes Beispiel führe ich weiter unten an.) So gehört die Sprachscham zur Ernte der Drachensaat der 68er und ist nichts weiter als ein Konstrukt oder Potemkinsches Dorf, das auch oder vor allem von Politikern, z. B. jenem, der kürzlich den Vorschlag machte, NRW aus der Bundesrepublik zu lösen und einem Rheinstaat zuzuschlagen, oder den Mitgliedern der Toskana-Fraktion, die Sachsen gerne als Ausland behalten hätten, und ihren Hilfstruppen der schreibenden Zunft, gezimmert wurde.
(Wie anders ist doch das Selbstbewusstsein der Engländer. Es lohnt sich, als Beispiel aus der Abschiedsrede Tony Blairs zu zitieren: „This country is a blessed nation. The British are special. The world knows it. In our innermost thoughts, we know it. This is the greatest nation on earth.“)
Das Eindringen der amerikanischen Sprache ins Deutsche erfolgte in der Industrie (und die Industrie ist bis heute der stärkste Motor der Amerikanisierung geblieben). Amerikanische Unternehmen, die nach dem Krieg in Europa Fuß fassen wollten, gingen vorrangig nach Deutschland. Deutschland war der größte Markt und besaß viele Standortvorteile, darunter die damals noch vorhandenen Facharbeiter. (Procter & Gamble zum Beispiel kaufte schon Mitte der sechziger Jahre die Rei-Werke in Boppard und ließ in der Zentrale in Frankfurt von Anfang an alle Memos auf Englisch schreiben.) Der Boden war durch die Besatzung und die Historie gut vorbereitet: Opel und Ford waren schon lange amerikanische Unternehmen. Frankreich dagegen schottete sich ab, und in Spanien gab es überhaupt keine Industrie. (Kauften Amerikaner französische Firmen, kamen sie mit der Mentalität nicht zurecht. Beispielsweise erwarb Chrysler Simca und musste es schon weniger Jahre später – auch wegen der eigenen Krise – an Peugeot abgeben. Peugeot benannte Simca in Talbot um, und zwei Jahre später war die Marke tot … but that’s a different story.)
Die Amerikanisierung der Managementsprache erfolgte in fünf Wellen. Die Berater (McKinsey, BCG, BAH, ADL usw.) drangen in den siebziger Jahren mit ihren Strategie-, Kostensenkungs- und Reorganisationskonzepten in deutsche Unternehmen ein, schließlich sogar in die nationalen Heiligtümer wie Daimler-Benz und predigten amerikanische Begriffe.
Die zweite Welle kam mit der Einführung der Personalcomputer auf breiter Front etwa ab 1986 und Texten wie z. B. der unvergesslichen Begrüßung: „Willkommen zu Macintosh!“
Die dritte große Welle hieß Reengineering, Benchmarking und Outsourcing, sie brandete ab 1991 über die Unternehmen hinweg. Während man bei der ersten Welle noch Versuche unternommen hatte, neue Begriffe zu übersetzen (so war aus value chain Wertschöpfungskette, aus experience curve Erfahrungskurve geworden usw.), gab man sich jetzt schon keine Mühe mehr, stattdessen wurden sogar bewährte deutsche Begriffe abgeschafft und durch Importe ersetzt, aus Beschaffung wurde procurement und aus einem Ablauf ein work-flow oder ein Prozess usw.
Die vierte Welle bildete sich leicht zeitversetzt aus den Zusammenschlüssen der WP-Gesellschaften zu Megakraken (mit 100.000 Mitarbeitern und mehr), ihrem Eindringen ins Beratungsgeschäft (mit Implementierung von Software wurde z. B. Andersen groß) und der parallelen Ausbreitung der Heuschrecken wie KKR usw. im Zuge der Globalisierung, und die fünfte Welle (nein, keine Welle mehr, auch kein Kaventsmann, sondern Dauerhochwasser, als wäre das Polareis schon abgeschmolzen) brachte das Internet.
Die Globalisierung und das Internet haben für die überschaubare Zukunft Amerikanisch als Standard festgeschrieben. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um?
Wenden wir uns dem Uni-Betrieb als drittem Antriebsmotor zu. Dazu kann ich im Augenblick nur ein Blitzlicht bieten: Etwa vor zwei Monaten schickte mir eine Studentin ihre Diplomarbeit mit der Bitte, sie zu kommentieren. Die Arbeit trug den schönen Titel: „Divergenz, Konvergenz und Perspektiven der Emotionen in dyadischen Interaktionen.“
Was soll man zu der sprachlichen Kreativität dieses Professors sagen? Ich zolle ihm Lob für seinen Erfindungsreichtum, das mir bislang nur aus der Computerei bekannte Wort „dyadisch“ in die Wissenschaftsfelder Soziologie, Sozialpsychologie und Pädagogik überführt zu haben. So entwickelt man die Suada der Fachsprachen! Aber ehrlich: Was für ein Schwachsinn! Beim ersten Durchblättern wurde deutlich, dass die Arbeit die Gefühle zwischen zwei Menschen behandeln sollte unter besonderer Herausstellung der Wirkung der Eifersucht (mit Feldversuch). Als mir beim zweiten Lesen auffiel, dass das arme Mädchen auf den ca. 150 Seiten ihrer Arbeit nur von Emotionen schrieb, aber die Worte Gefühl und Stimmung nicht verwendete, war ich sehr verwundert, schlug in einigen Büchern nach und entdeckte, dass noch vor vierzig Jahren die deutschen Psychologie-Professoren nur von Gefühlen und Stimmungen gesprochen und das Wort Emotion nicht verwendet hatten. (Im Duden jener Jahre wurde Emotion als Erregung, also als ein spezieller Gefühlszustand erklärt.) Irgendwann müssen die Profs der nächsten Generation beschlossen haben, das Gefühl abzuschaffen und es durch das englische Wort Emotion zu ersetzen. Beim dritten Lesen der Arbeit bin ich dann doch einmal auf das Wort Gefühl gestoßen. Der Satz lautete: „Unter bestimmten Bedingungen kann man bei Emotionen auch Anzeichen von Gefühlen entdecken.“ No fake, es ist ein Jammer!
Die vierte Sponsorengruppe sind die Journalisten. Sie folgen der Karawane und schreiben auf, was man ihnen zuwirft. Außerdem nimmt die Abschreiberei zu. Mir ist schon vor zehn Jahren aufgefallen, dass Artikel aus dem Wochenmagazin Time eine oder zwei Wochen später mehr oder weniger als Übersetzung in deutschen Wochenmagazinen zu finden waren. Besonders schlimm zeigt sich sprachliche Verwahrlosung in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen. Da werden Netzwerke gestrickt, bis die Nadeln glühen usw. usw.
Im letzten Teil Ihres Textes beklagen Sie den mehrsprachigen Unterricht an Gymnasien. Gegen bilingualen Unterricht wäre aus meiner Sicht nichts einzuwenden, hätten wir intelligente Schüler. Sie lernten, Sprachen zu vergleichen und Transfers zu machen. Sie lernten, die Vorteile der deutschen Sprache und ihre Flexibilität zu schätzen. Was wir z. B. mit unseren Verben durch die Benutzung verschiedener Vorsilben anstellen können, ist im Englischen und Französischen völlig unmöglich. Gegen den mehrsprachigen Unterricht wäre aus meiner Sicht nichts einzuwenden, lernten die Schüler wenigstens Englisch. Aber das tun sie nicht! Sie sind nicht intelligent und motiviert genug, außerdem sind die Klassen zu groß – Kurse mit über 30 Schülern sind keine Seltenheit.
Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten (teilweise Eltern, teilweise Lehrern) kenne ich im Großraum Düsseldorf ein wenig die Lage an einem halben Dutzend Gymnasien und möchte folgende Zusammenfassung geben: Viele Abiturienten, die heute die Gymnasien verlassen, beherrschen weder Deutsch noch Englisch. Sie können kein Englisch, weil sie aus Gleichgültigkeit und Faulheit in der Mittelstufe keine Vokabeln lernen (und von gleichgültigen oder zermürbten Lehrern dazu auch nicht angehalten werden) und sich die Grundregeln der Grammatik nicht aneignen. Erreichen sie die Oberstufe, sollen sie Texte analysieren. (Warum? Bisher konnte mir noch niemand überzeugend erklären, was Textanalysen mit dem Erlernen einer Fremdsprache zu tun haben.) Dazu bekommen sie einen Werkzeugkasten mit rhetorischen Mitteln in die Hand gedrückt und sind völlig aufgeschmissen. Sie verstehen die Texte inhaltlich nicht und verfügen weder über die Grammatik noch über das Vokabular sich auszudrücken – verstünden sie den Text. Zwei Beispiele: In einer Arbeit über Tony Blairs Abschiedsrede im Parlament mit einem Auszug seiner Rede schrieb eine Schülerin: „In the extract speech written by T. B. on 10th May 2007 ….“
Beispiel 2 (aus einem Französisch-Leistungskurs, Klasse 13): In einer Arbeit über das Verhältnis von Frankreich und anderen europäischen Staaten zu Saudi-Arabien und dem Islam schrieb ein Schüler sinngemäß: „In Mekka, einer kleinen Stadt im Süden Frankreichs …“
Ich habe den Eindruck, dass die Zensuren die tatsächlichen Leistungen nicht widerspiegeln, sondern dass sie aus schultaktischen Gründen oft angehoben werden. Die Gymnasien stehen im Wettbewerb und starren in jedem Herbst gebannt auf die Neuanmeldungen. Sind sie rückläufig, entsteht Existenzangst. Die SPD-Freunde der Gesamtschule erheben nämlich schnell ihre Stimme, um eine Schulschließung und die Integration in die nächste Gesamtschule zu fordern. Um Eltern nicht abzuschrecken, haben viele Gymnasien Angst vor einem Ruf, Leistung zu fordern, und schleppen auch unbegabte Schüler zum Abitur. Der Schüler als durchlaufender Posten: Das Gymnasium ist zur Lebensabschnittsverweil- und -verwahranstalt verkommen.
Auch das Zentralabitur, das in diesem Jahr mit großem Getöse in NRW eingeführt wurde, ist ein großer Schwindel. Es dient nicht dazu, die Leistung anzuheben, sondern soll nur den Notendurchschnitt (durch Minderung der Anforderungen auf das Niveau der Gesamtschulen) in besserem Licht erscheinen lassen. Der Fehlerquotient in Englisch wurde abgeschafft, Content ist alles, Grammatik- und Wortfehler spielen keine Rolle mehr. Die Schulpolitik der CDU ist leider keinen Deut besser als die der SPD. Die ausführenden Köpfe sind halt auch Kinder und Bildungsopfer der 68er.
Was forderten die Redner der ersten Turnschuhgeneration vor vierzig Jahren? Alle sollen gleich sein! Sie haben ihren Orwell nicht gründlich gelesen und ein Adjektiv vergessen: dumm. Sie hätten rufen sollen: Alle sollen gleich dumm sein! Die Abschaffung der Hochsprache ist dazu ein probates Mittel.
PS:
Die Internationalisierung/Amerikanisierung von Markennamen wäre eine eigene wisenschaftliche Arbeit wert. Dazu gibt es Material in Hülle und Fülle. Drei Beispiele: Procter & Gamble startete in Deutschland mit einem Gemisch aus amerikanischen und deutschen Markennamen. Ein Allzweckreiniger wurde als Meister Proper eingeführt, die Hauptmarke Tide wegen der Ausspracheprobleme dagegen nie, stattdessen wurde Cascade gegen Persil gesetzt. Jahre später war es bei Head & Shoulders schon völlig anders. Auch Mars (Süßwaren und Tiernahrung) startete mit einer Mixtur der Namen. Das Hundefutter Pedigree wurde in Deutschland unter dem Namen Pal eingeführt, die Rückbenennung erfolgte erst in den 90er Jahren. Auch Opel bietet mit der Geschichte seiner Markennamen vom Olympia-Rekord, Kapitän und Kadett über den Ascona zum Vectra reichlich Stoff …
Bei der Unterwerfung der Politiker, der Professoren und der Manager darf man natürlich auch nicht vergessen, dass sich im letzten Vierteljahrhundert die Industriesektoren außerordentlich gewandelt haben: Noch Anfang der achtziger Jahre bildete die deutsche Pharmaindustrie die Spitze der Welt, geforscht wurde hier, die Megafusionen hatten noch nicht stattgefunden. Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau produzierte noch in Deutschland und exportierte weltweit.
Der Markt der Informationstechnologie, der der hauptsächliche Treiber für die Dominanz des Amerikanischen ist, steckte in den Kinderschuhen, und niemand sah die Entwicklung voraus.
Das gilt entsprechend für die Nanotechnologie, die Mikrochirurgie und die Gentechnologie.
Auch auf den Gebieten Unternehmensführung, Unternehmensstrategie und Marketing kamen die Entwicklungen und Anstöße aus den USA, die deutschsprachigen Professoren (wie Hinterhuber, Kirsch, Meffert, Töpfer) beteten nur nach. Nach kreativen Köpfen wie Henry Mintzberg sucht man hier vergebens. Der Beweis für diese unangenehme Behauptung ließe sich durch eine kleine vergleichende Analyse der letzten dreißig Jahrgänge der Harvard Business Review und z. B. der ZfbF leicht erbringen.
Und schließlich: Die deutsche Schwäche in Brüssel ist hausgemacht. Sie liegt an der Schwäche der deutschen Wirtschaftminister und an den entsandten höheren Beamten. Wer seinen Standpunkt nicht vertritt, wird in die Ecke gedrängt …
(Okt. 2007)
Im Jahr 1520 unternahm Albrecht Dürer eine Reise nach Flandern, lernte in Antwerpen Joachim Patinir kennen und lobte ihn in seinem Tagebuch als guten Landschaftsmaler. Mit dieser Bemerkung tauchte ein neuer Begriff in der deutschen Sprache und in der Kunstgeschichte auf. Zwar hatte die Abbildung der Landschaft im Lauf des 15. Jahrhunderts sowohl in der italienischen Renaissance als auch in der spätgotischen Malerei nördlich der Alpen an Bedeutung gewonnen, aber sie war noch nicht zum eigentlichen, eigenständigen Thema von Gemälden geworden, sondern war Hintergrund für die Darstellung religiöser Ereignisse oder Porträts des Adels und des reichen Bürgertums geblieben. Aber kürzlich hatte Albrecht Altdorfer eine Waldlandschaft gemalt, in der der einzige Mensch zwischen den Bäumen kaum zu erkennen war, kurz vorher hatte Giorgione „Das Gewitter“ gemalt, in dem die Landschaft größere Bildanteile als die dargestellten Personen hatte, und etwa zu der Zeit, als Dürer den Begriff Landschaftsmaler prägte, malte Altdorfer eine Donaulandschaft ganz ohne Menschen, man sah nur Wald, den Fluss und in der Ferne eine Burg.
Auch für Patinir war die Landschaft noch nicht das eigentliche Thema, sie bildete immer noch nur den Hintergrund für irgendeine Geschichte aus der Bibel oder einer Heiligenlegende. Beim Bildaufbau verfuhr er traditionell, wählte Braun für den Vordergrund, Grün für den Mittelgrund und Blau für die Ferne. Aber er verschob den Blickpunkt nach oben. Durch diesen Bildaufbau mit dem hochliegenden Blickpunkt, als schwebe der Betrachter in einem Ballon in großer Höhe über die Welt, verschiebt sich die Perspektive. Die Landschaft breitet sich panoramaartig aus, vermittelt Weiträumigkeit und wird zur Weltlandschaft. Die Figuren, die Häuser und die Städte in der Landschaft sind klein geworden, die Figuren im Vordergrund dagegen sind für die Landschaft hinter ihnen zu groß, außerdem folgen sie der Bildperspektive nicht, sondern zeigen sich dem Betrachter fast immer frontal. Dadurch stehen sie oft fremdartig in ihrer Umgebung und sind nicht in die Landschaft eingebettet. Die großen Figuren gaben lange Rätsel auf. Heute sind die Kunsthistoriker überwiegend der Meinung, dass sie von Malern aus dem Umkreis Patinirs geschaffen und nachträglich eingefügt wurden, zumal sie den typischen Merkmalen der kleineren Figuren (lange Nasen, schmale Köpfe, schwarze Augen, plumpe Handgelenke, große Füße) nicht entsprechen. Dass Quentin Massys bei einigen Bildern, etwa der Madrider Versuchung des heiligen Antonius, die Figuren gemalt hat, gilt als sicher.
Patinir starb früh und hinterließ ein schmales Werk (heute werden ihm etwa dreißig Gemälde zugeschrieben), das thematisch durch Variation und Wiederholung von Motiven noch schmaler wird: Allein von dem Motiv „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ gibt es zehn und von der „Landschaft mit dem heiligen Hieronymus“ neun Fassungen. Unabhängig vom Bildthema spielen in seinen Bildern das Meer und ein Fluss eine große Rolle. In der Hälfte seiner erhaltenen Gemälde sieht man am fernen Horizont das Meer, wobei es sich auf den meisten dieser Bilder mit Buchten oder Flussmündungen weit ins Land erstreckt. Auf elf weiteren Gemälden ist ein sich windender Flusslauf zu sehen, der von steilen weißgrauen Felsen begrenzt wird. Nach Ansicht von Kunsthistorikern handelt es sich bei diesem Motiv um die Maas bei Dinant, dem Herkunftsort Patinirs.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich zum ersten Mal etwas über Dürers Begegnung mit Patinir gelesen habe – vermutlich beim Durchblättern der Erstausgabe von Kindlers Malerei-Lexikon. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wann ich zum ersten Mal ein Gemälde von Patinir im Original gesehen habe – vermutlich bei jenem Besuch im Kunsthistorischen Museum in Wien, bei dem mich Dossis Parabel von Jupiter und der Tugend (vgl. den Eintrag vom Mai 2006) zum Staunen gebracht hatte. In Wien muss ich die Landschaft mit der Taufe Christi gesehen haben.
Einige Jahre später erschien bei der Edition Laffont eine sehr schön gestaltete Monographie über Patinir mit vielen Detailansichten der Hintergrundlandschaften. Die deutsche Ausgabe bei DuMont trug den Titel „Patinir oder die Harmonie der Welt“.
Jetzt wurden für eine Retrospektive in Madrid fast alle Gemälde Patinirs zusammengeführt, was dem Besucher erlaubt, die besondere Qualität der Landschaftsmalerei genau zu studieren: die feinen Abstufungen von transparentem Blau für den Hintergrund, die Schattierungen des Wassers, den Reichtum an Einzelheiten, Bauern bei der Arbeit, Jagdszenen, marodierende Soldaten, einzelne Wanderer, die phantastischen Kirchen und Felsenklöster, Stadtbefestigungen, Schiffe aller Art und bizarren Felsen.
Zu den Meisterwerken, deren Thema Patinir nicht wiederholte, gehört „Charon überquert den Styx“, das auch „Überfahrt in die Unterwelt“ genannt wird. Das Bild ist vertikal in drei Zonen geteilt. In der Mitte fließt der Styx zum fernen Horizont, links liegt das Paradies, Engel gehen darin spazieren, und im Hintergrund ist der Brunnen des Lebens zu erkennen, dessen Form eine Huldigung für Bosch sein könnte. Auf der rechten Seite des Flusses sieht man das Tor zur Hölle samt Zerberus. In unmittelbarer Nähe liegt ein Garten mit Früchte tragenden Bäumen, Papageien und blühenden Büschen, mit weißen Lilien und roten Rosen – offensichtlich ein falsches Paradies, das die Menschen auf den Weg zur Hölle locken sollen.
Mitten auf dem Fluss rudert Charon sein Boot und führt eine Seele mit sich, die ängstlich zum Höllentor sieht und nicht bemerkt, dass ein Engel ihr zuwinkt. Noch scheint Charon sich nicht entschieden zu haben, ob er die Einfahrt zum Paradies oder zur Hölle ansteuern soll, allerdings hat er seinen Körper der Hölle zugewendet, während sein Blick starr nach vorn gerichtet ist.
Ein anderes Meisterwerk, das Patinir nicht wiederholt hat, ist die „Versuchung des heiligen Antonius“. Auf einem Hügel im Vordergrund sieht man den Heiligen, umgeben von drei schönen Frauen und einer alten Vettel. Dunkler Wald bildet den Mittelgrund der Landschaft, in der Ferne liegt ein silbern glänzender See unter dunklem, teilweise schwarzem Himmel, und eine langgestreckte Bergkette ohne die üblichen schroffen Felsen und steilen Gipfel schließt den Horizont ab. Die drei Frauen sind sehr elegant gekleidet (modisch sind sie auf der Höhe der Zeit), mit graziösen Gebärden haben sie sich Antonius genähert, ihn umstellt und eingekreist. Lächelnd sind sie offensichtlich bemüht, ihm ihre beste Seite zu zeigen. Eine bietet ihm einen Apfel an, eine andere klatscht in die Hände und die dritte streichelt seinen Hals. Diese drei Verführerinnen hätten mit ihrer betörenden Anmut wahrscheinlich jedem Mann den Kopf verdreht, auch Antonius scheint verloren, mit einer matten Geste versucht er noch, den Ansturm abzuwehren. Jetzt könnte man die Bildbeschreibung mit einem Vergleich fortsetzen, mit Boschs Versuchung des heiligen Antonius, dem großen Triptychon, das sich in Lissabon befindet, aber dieser Vergleich würde den Rahmen dieser Skizze sprengen. Stattdessen möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Versuchungsszene noch dreimal auf dem Bild wiederholt wird: im Mittelgrund rechts in einem See im Wald, auf dem zwei Damen in einem Boot sitzen und zwei halbnackt im Wasser stehen; dann etwas weiter entfernt in der Hütte des Einsiedlers und schließlich (auf Reproduktionen kaum erkennbar) in der schwarzen Wolke am Himmel.
Da im Gegensatz zu den anderen Gemälden mit großen Figuren sich alle Personen gut in die Landschaft einfügen, ist die Versuchung des heiligen Antonius vom Bildaufbau her und mit seiner zurückgenommenen Farbigkeit meiner Ansicht nach das beste Gemälde, das Patinir geschaffen hat.
(Sept. 2007)
Nachtrag: In einem Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung beschäftigt sich der Kunsthistoriker Thürlemann mit dem Wiener Gemälde „Die Taufe Christi“, auf dem im Vordergrund Christus im Wasser des Jordans steht und von Johannes getauft wird. Der Fluss windet sich diagonal durch die Landschaft und stürzt im Hintergrund als schäumender Wasserfall ins Bild hinein. Dieser Wasserfall mit seinen Felsformationen und dem dahinter aufragenden Schlossberg gleiche, das ist Thürlemanns These, dem Katarakt bei Schaffhausen und sei damit die früheste bekannte Darstellung des Rheinfalls. Ob allerdings Patinir jemals eine Reise unternahm, die ihn nach Schaffhausen führte, ist nicht belegt. (Im Februar 2014)
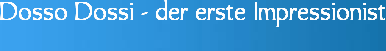
Zu den ungewöhnlichsten und auf den ersten Blick thematisch kaum verständlichen Gemälden in der italienischen Abteilung des Kunsthistorischen Museums in Wien gehört ein Bild, auf dem man drei Personen sieht: links einen älteren Mann in einem roten Gewand, der vor einer Staffelei sitzt und einen Schmetterling malt, in der Mitte einen nackten Mann mit einem geflügelten Helm, der seinen Kopf zur anderen Seite gewendet hat, eine kniende Frau in einem gelben Gewand anblickt und einen Zeigefinger als Geste des Schweigens vor die Lippen hält. Gemalt wurde das Bild von Dosso Dossi, und als Titel wird „Jupiter, Merkur und die Tugend“ angegeben. Vermutlich wird der Titel den meisten Betrachtern nicht weiterhelfen, zumal sie auch mit dem Namen des Malers nichts anzufangen wissen – so erging es mir wenigstens, als ich zum ersten Mal dieses Wiener Museum besuchte.
Tatsächlich ist über das Leben von Dosso Dossi wenig bekannt. Um 1490 oder früher vermutlich in Mirandola zwischen Mantua und Modena geboren, lebte er einige Zeit in Venedig, bevor er Hofmaler der Herzöge von Este in Ferrara wurde und dort bis zu seinem Tod im Jahr 1542 tätig war. Besonders charakteristisch für seine Malweise war der Verzicht auf eine Vorzeichnung, er komponierte seine Figuren direkt auf der Leinwand und veränderte dort ihre Stellungen. Seine Landschaften mit den oft gelblich schimmernden Bäumen erinnern an Giorgione, dessen Gemälde er vermutlich in Venedig gesehen hatte. Außerdem stand er etwa zwei Jahre lang in engen Kontakt mit Tizian, als der am Hof zu Ferrara weilte. Von Giorgione und Tizian hat er auch gelernt, seine Figuren elegant in die Landschaft einzubetten. Im Lauf der Jahre wurden seine Landschaften immer origineller und lebhafter mit flirrenden, prickelnden Farben und starken Farbkontrasten, indem er sattes Gelb neben leuchtendes Blau setzte. Manche Bilder wirken wie ein vorweggenommener Impressionismus.
In Ferrara ist von seinen Gemälden nichts mehr zu sehen, weil das Herzogtum nach dem Aussterben der Este vom Kirchenstaat geschluckt wurde und Papst Clemens VIII. die Kunstsammlung der Herzöge verkaufen ließ. Nur die bereits im 15. Jahrhundert entstandenen Fresken im Palazzo Schifanoia, die berühmten Monatsbilder, verblieben der Stadt.
Die erste Retrospektive des vor vierhundert Jahren zerstreuten Werks von Dosso Dossi wurde 1998 zunächst in Ferrara und anschließend in New York sowie in Los Angeles gezeigt und enthielt rund sechzig Exponate. Von den davon vierzig Dosso Dossi zugeschriebenen Gemälden halte ich drei für herausragend: das schon erwähnte Werk in Wien, außerdem „Melissa“ und die „Allegorie mit Pan“.
Um „Jupiter, Merkur und die Tugend“ zu verstehen, beginnt man am besten mit dem Vordergrund und der Frage, wo wir uns eigentlich befinden. Der Vordergrund ist grau und wolkig, offensichtlich sitzen die Figuren auf einer Wolke über der Erde. Bei der mittleren Figur handelt es sich zweifelsfrei um Hermes, den Götterboten, der in der römischen Mythologie Merkur genannt wurde. Seine Kennzeichen sind nicht nur der geflügelte Helm, sondern auch die kleinen Flügel an den Fersen und der Stab, den er mit der linken Hand festhält, ein Stab mit zwei sich überkreuzenden Schlangen, der einem Boten freies Geleit zusicherte. Da damit die Identität der zentralen Figur des Gemäldes zweifelsfrei geklärt ist, ergibt sich, dass die linke Gestalt Jupiter sein muss, der dabei ist, die Schmetterlinge zu erschaffen, und deshalb die Ankunft der Frau nicht bemerkt hat oder in seinem Schöpfungsprozess nicht gestört werden will. Wer aber ist die Frau? Nach der Bildlegende die Tugend. Was will sie von Jupiter? Sie will eine Beschwerde vorbringen und beklagt, dass sie von Göttern und Menschen, vor allem aber von der Göttin Fortuna viel Ungerechtigkeit zu erdulden hätte. Sie will diese Beschwerde Jupiter vortragen, aber Merkur verweigert ihr die Audienz. Er weiß, dass Jupiter an ihrem Schicksal völlig desinteressiert ist und nicht bereit wäre, sie anzuhören.
Schon im 17. Jahrhundert rätselte man über die literarische Quelle dieser Szene und glaubte, sie stamme aus einem Werk des griechischen Satirikers Lukian. Tatsächlich jedoch diente ein im 15. Jahrhundert entstandener Dialog des Italieners Leon Alberti als Vorlage. Dieser Dialog endet übrigens mit dem Rat Merkurs an die Tugend, abzuwarten. Denn auch Jupiter sei Fortuna unterworfen und vermöge nichts gegen ihre Macht.
Das Gemälde „Melissa“, das heute in der Galleria Borghese in Rom hängt, könnte man auf den ersten Blick für das Porträt einer Frau vor einer phantastischen Landschaft halten, wenn es nicht zu ungewöhnliche Zutaten enthielte. Die sitzende Frau hat ihre Haare mit einem goldenen Turban bedeckt und ist auch sonst nicht nach der Mode der Zeit gekleidet (wie man sie beispielsweise aus den Frauenporträts von Raffael kennt), sondern trägt ein phantastisches, orientalisch anmutendes Gewand. Obwohl es lichter Tag ist, hält sie eine brennende Fackel in der linken Hand und in der rechten Hand eine Holztafel, auf deren weißen Grundierung eine mathematische oder architektonische Zeichnung zu erkennen ist. Rechts von ihr sitzt ein grauer Hund, der eine silberne Rüstung betrachtet, und im Geäst eines Baumes hängen vier kleine hölzerne Figuren, die Kinderspielzeug sein könnten, aber für unser modernes Verständnis eher Voodoo-Puppen gleichen.
Da man sich auf die verschiedenen Objekte keinen Reim machen konnte, trug das Bild früher den Titel „Circe“ oder auch nur „Die Zauberin“. Erst um 1900 wurde eine naheliegende Verbindung zum „Orlando Furioso“, dem rasenden Roland von Ariost, vermutet, zumal Ariost Hofpoet in Ferrara war und die erste Fassung der Versdichtung 1516 drucken ließ. So wurde bei der Bildinterpretation aus Circe, die die Besucher ihrer Insel in Tiere verwandelte, die freundliche Zauberin Melissa, die im rasenden Roland christliche Ritter aus den Händen der bösen Zauberin Alcina befreit. Zur Unterstützung dieser These wurde darauf hingewiesen, dass die Burg im Hintergrund der Landschaft der von Ariost beschriebenen Burg Alcinas ähnele. Bei der Vorbereitung der Retrospektive und der Durchleuchtung des Bildes entdeckte man allerdings, dass an der Stelle des Baumes ursprünglich eine stehende männliche Figur gemalt war, zu der Melissa aufblickt. Wer der Mann war und warum Dosso Dossi ihn wieder übermalte, ist ungeklärt.
Kompositorisch und maltechnisch ist „Melissa“ ein außerordentliches Werk, die farbige Behandlung der stofflichen Beschaffenheit des Kleides ist von hoher Qualität, wie man sie sonst nur bei Bronzino (z. B. im Porträt der Eleonora von Toledo) und in Gemälden niederländischer Maler der Spätgotik findet. Das strahlende Rot und das leuchtende Blau des Gewandes erreichte Dossi durch Auftragen einer roten Lasur auf Zinnoberrot und einer blauen Lasur auf Azurblau.
Auch bei dem dritten Gemälde, der „Allegorie mit Pan“, die heute im Getty Museum in Los Angeles hängt, ist der mythologische Bezug noch immer rätselhaft. Auf dem Bild sieht man vier Personen. Auf einem Blumenbett liegt im Vordergrund vor einer Baumgruppe eine schlafende Nackte in einer Haltung, wie sie zuerst von Giorgione als schlafende Venus gemalt und später von Tizian in seinem Bacchanal und als Venus von Urbino wiederholt wurde. Hinter dem Kopf der Schlafenden sitzt eine alte Frau, die ihre Hände abwehrend ausgestreckt hält, links von ihr steht eine weitere, aber jüngere Frau in einem grünen Kleid und gebauschten roten Mantel, und rechts unter der Baumgruppe sieht man Pan, der auf die Schlafende blickt und in einer Hand ein halb geöffnetes Buch hält. Links im Hintergrund befindet sich eine schöne Landschaft mit einer gotischen Stadt, und am Himmel sieht man eine Gruppe von Amoretten, die ihre Liebespfeile abschießen. Zu den weiteren Merkwürdigkeiten gehört, dass einer der Bäume Zitronen trägt, die überproportional groß sind. Außerdem zeigte die Durchleuchtung, dass in einer früheren Fassung Pan fehlte, die Haltung der beiden Frauen mehrfach geändert wurde und die Frau in dem roten Mantel wiederum lange übermalt war. Mit anderen Worten, es gab zwei Versionen, in denen jeweils nur drei Personen zu sehen waren, Pan und die Frau im roten Mantel aber nie zusammen. Im Begleittext des umfangreichen Katalogs der Retrospektive wurden zur Bildbedeutung nur Vermutungen angestellt, die schlafende Nymphe könnte Antiope sein oder Echo oder Syrinx oder auch Canens. Wir wissen es nicht.
Etwa seit 1520 arbeitete Dosso Dossi häufig mit seinem jüngeren Bruder Battista zusammen, über dessen Lebenslauf man noch weniger weiß. Battista Dossi wird heute ein halbes Dutzend Gemälde zugeschrieben, darunter ein Schlüsselbild des Manierismus mit dem Titel „Der Traum“ oder „Die Nacht“. Dieses Gemälde, das ich sehr schätze, gehört heute zum Bestand der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden, ist aber zur Zeit nicht ausgestellt und befindet sich im Depot. Sehen konnte man es 1997 in Köln in der sensationellen Ausstellung: „Das Capriccio als Kunstprinzip – Zur Vorgeschichte der Moderne von Arcimboldo bis Goya“.
(Mai 2006)
Als der Hessische Rundfunk Mitte der 60er Jahre sein drittes Fernsehprogramm startete, war eine der ersten Sendungen ein zweiteiliger Beitrag über die Kunst des Manierismus. Ob ich den Begriff „Manierismus“ vor diesem Zeitpunkt schon einmal gehört hatte, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall fand ich die Darstellung der Kunst zwischen 1520 und 1620 so faszinierend, dass ich die im Abspann genannten Monographien „Der Manierismus“ von Franzsepp Würtenberger und „Die Malerei des Manierismus“ Jacques Bousquet sowie „Die Welt als Labyrinth“ von Gustav René Hocke sofort kaufte. Von den ungewöhnlichen Bildern sind mir viele im Gedächtnis geblieben, darunter auch ein Gemälde von Marten van Heemskerk, das nur bei Würtenberger und nur in Schwarz-Weiß abgebildet war: „Der heilige Lukas malt die Madonna mit dem Kind“. Dieses schon aus der Spätgotik bekannte Motiv hat Heemskerk stilistisch und ikonographisch neu erdacht: Von einer großen Staffelei, deren vertikales Brett bizarr in einem hölzernen Männerkopf endet, wird das Bild in zwei Hälften geteilt. Zur Madonna (links) und zum Maler (rechts im Bild) gesellen sich ein Engel und eine weitere Person. Gesichtszüge und Bekleidung sind sorgfältig gemalt, die Blicke eindeutig aufeinander bezogen: Die unbekannte Person sieht den Maler an, der Maler blickt auf sein Bild, der Engel sieht Maria an, die das Jesuskind und das wiederum gestenreich den Maler. Alle Figuren sind in Untersicht dargestellt und befinden sich nicht in einer Wohnstube oder einem Palastraum oder in der freien Natur, sondern vor einer dunklen Wand an einem unbestimmbaren Ort ohne Fenster und Türen. Allenfalls könnte man sich wegen des tiefen Blickpunktes des Betrachters vorstellen, die Szene spiele auf einem Podest in einem abgedunkelten Raum, dessen einzige Beleuchtung von einer Fackel stammt, die der Engel hält. Da der Engel mit der Fackel hinter der Staffelei steht, dürfte das Bild auf der Staffelei eigentlich gar kein Licht erhalten und müsste im Dunkeln liegen. Dem ist aber nicht so …
Damals rätselte ich weniger über die Lichtquellen als über die Farbgebung, wurde aber bei der Suche nach einer farbigen Abbildung nicht fündig und stieß nur noch auf ein Familiengemälde mit zwei kichernden Kindern, das Heemskerk als guten Porträtmaler auswies.
Einen ganz anderen Marten van Heemskerk konnten Besucher der großen Brüsseler Ausstellung „Fiamminghi a Roma“ im Jahr 1995 kennenlernen. In dieser Ausstellung, die die Zeitspanne von 1508 bis 1608 umfasste und 250 Gemälde, Zeichnungen und Stiche zeigte, war auch ein großformatiges Gemälde von Heemskerk zu sehen, das seit einhundert Jahren in der Walters Art Gallery in Baltimore hängt und in Europa kaum bekannt ist: eine „Landschaft mit dem Raub der Helena“, die zeitweise auch den Titel „Die Sieben Wunder der alten Welt“ trug, weil man schon auf den ersten Blick im Hintergrund eine Hafeneinfahrt mit dem Koloss von Rhodos erkennen kann. Im ungewöhnlichen Format von fast vier Metern Länge und einer Höhe von einem Meter fünfzig breitet Heemskerkein Panorama mit Städten, Ruinen, Bergen und Küsten aus. Etwas vereinfacht könnten man sagen, Heemskerk habe ein Weltpanorama im Stil, in den Farben und dem hohen Horizont von Patinier gemalt und dabei das Bild diagonal von links unten nach rechts oben geteilt, wobei die Küstenlinie, die das Land vom Meer trennt, der Diagonale folgt.
Jetzt hat Martin Stritt im Stroemfeld Verlag eine opulent ausgestattete Studie über dieses Bild unter dem Titel „Die schöne Helena in den Romruinen“ veröffentlicht. Stritt vertritt die These, bei der verwirrenden Stadtlandschaft handele es sich um die Topographie von Rom, wie sie sich nach dem Sacco die Roma in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts darbot und wie sie andererseits in antiker Zeit ausgesehen haben könnte. Stritt belegt seine Ansichten mit vielen Einzelheiten und Abbildungen, darunter Stichen und Zeichnungen Heemskerks aus seinem mehrjährigen Aufenthalt in Rom. Man kann z. B. die Milvische Brücke erkennen, Flussgötter vom Kapitol, die antike Statue eines Löwen, der über ein Pferd herfällt, und den Torso vom Belvedere.
Der titelgebende Raub der schönen Helena findet im Vordergrund des Bildes eher beiläufig statt und besteht aus einer Gruppe von neun Personen, die auf dem Weg zu wartenden Schiffen sind. Helena und Paris sitzen zu Pferde, Helena lächelt und blickt zu Paris. Ihr Gesicht ist etwas pausbäckig und entspricht nicht unseren Erwartungen von außergewöhnlicher Schönheit. Betrachtet man die anderen Personen näher, springen einem die schlecht proportionierten Körper der Männer mit zu dicken Beinen und Armen und teilweise zu großen Köpfen ins Auge. Die gesamte Gruppe wirkt unbeholfen gemalt. Nanu, denkt man, war Heemskerk nur ein Stümper? Nein, war er nicht. Das zeigt sich z. B. an dem nuancenreichen Porträt seines Vaters, das ebenfalls im Bildteil der Studie abgebildet ist. Meiner Meinung nach hat Heemskerk sich mit der scheinbaren Unbeholfenheit über den Mythos lustig gemacht und seinen Pinsel in den farbtopf der ironie getaucht. Einen Hinweis in diese Richtung gibt ein anderes Gemälde von ihm: „Vulkan zeigt den Göttern Mars und Venus im Netz.“ Auch auf diesem Bild ist die Göttin Venus keine berauschende Schönheit, sondern eher ein Dorfmädchen mit einer lächerlichen Frisur.
Die Beschäftigung mit Stritts Buch veranlasste mich, nun endlich einmal das Frans Hals-Museum in Haarlem aufzusuchen, um den heiligen Lukas mit der Madonna im Original gesehen. Die Farbgestaltung überraschte mich sehr. (Noch ein Hinweis: Zwanzig Jahre nach der ersten Fassung hat Heemskerck eine andere Version ohne Engel und Fackel gemalt, die sich heute in Rennes befindet.)
(Aug. 2005)
Mit Tageszeitungen bin ich groß geworden. Meine Großeltern hatten bereits in den 20er Jahren oder vielleicht sogar schon früher die Frankfurter Zeitung abonniert, und meine Großmutter las sie bis zu ihrem Verbot im Jahr 1943. Nach dem Krieg wollte sie unbedingt wieder eine Zeitung aus Frankfurt regelmäßig lesen. Da es aber die alte Frankfurter Zeitung nicht mehr gab, bestellte sie die Frankfurter Rundschau. Später übernahm meine Mutter das Abonnement, so dass diese Zeitung rund vierzig Jahre zu uns ins Haus gebracht wurde. Meine frühesten Erinnerungen an die FR waren die wöchentlichen Kinderseiten mit dem Namen „Onkel Benjamin“, auf der ich die Romane „Kai aus der Kiste“, „Der 35. Mai“ und vielleicht auch „Der Kampf der Tertia“ gelesen habe. Zusätzlich hielten wir uns noch eine Heimatzeitung. Die brauche man, erklärte meine Großmutter, um zu wissen, was sich so im Ort ereignet habe. Meine Erinnerung an die Heimatzeitung beschränkt sich auf einen Comic strip, der von den Abenteuern eines kleinen Panda erzählte, dessen ewiger Widersacher, aber auch Verführer ein hinterlistiger und höchst unmoralischer Fuchs war.
Berufsbedingt benötigte ich seit Anfang der 70er Jahre eine Tageszeitung mit einem brauchbaren Wirtschaftsteil, und nach einigen Vergleichen fiel meine Wahl auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ich seitdem abonniert und so gut wie jeden Tag gelesen habe. Von Anfang an habe ich aber auch das Feuilleton gelesen und über dessen Veränderung jetzt der Reaktion einen Leserbrief geschrieben:
Polemogene Umkleiden und gut gearbeitete Fische
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten dreißig Jahren hat sich Ihr Feuilleton mächtig verändert: Es ist größer, vielfältiger und bunter geworden. Junge Federn treten die Ernsthaftigkeit der kk-Zeit mit Füßen und schreiben frische, freche, witzige, ironische oder sarkastische Beiträge und texten Bildunterschriften, als seien sie bei Pardon oder Titanic in die Schule gegangen.
Bei ihren Worterfindungen bleibt einem manchmal vor Staunen der Mund offenstehen, sie zu lesen, ist selbst dann, wenn sie Raffinesse mit Wurstigkeit verwechseln, ein Vergnügen, aber nicht immer ...
Ich habe es mir zur lieben Gewohnheit gemacht, nach der Rückkehr aus der Sommerfrische die liegengebliebenen Ausgaben des Feuilletons durchzublättern, und bin dann immer ganz gespannt, wo meine Augen, die ihr Eigenleben haben und herumspazieren wollen, wohl hängenbleiben.
Diesmal stolperten sie in der Ausgabe vom 5.7.2005 über den Beitrag von Herrn Rixen: Zwischen Fatwa und Bikini. Nach dem schönen Satz „Rechtsstaatliche Rationalität ist immun gegen jeden Versuch einer quasi eschatologischen Aufladung des Rechts“ kam es noch dicker: „Er reduziert das polemogene Potential letzter Fragen …“
Bestürzt ließ ich das Blatt zu Boden fallen und fragte mich: Was bitte ist polemogen? Versuche, den Begriff abzuleiten, führten zu nichts. Folglich suchte ich Rat in Wörterbüchern: Fehlanzeige bei neuen und alten und noch älteren. (Auch mein Lieblingswörterbuch von Chr. Wenig, in dem man die tollsten Sachen findet, Erstausgabe 1821, hatte nichts zu melden.) Jetzt schon leicht wütend schmiss ich den Rechner an, um im Digitalen Grimm zu suchen. Aber ach, der Grimm ist lückenhaft und unzuverlässig. Selbst so ein einfaches Eigenschaftswort wie härnern, das ich schon als Kind nach der Lektüre der Märchen ins Herz geschlossen hatte und das der junge Brecht noch kannte, als er seine ersten Gedichte schrieb, ist im Grimm nicht aufgeführt. Der Not gehorchend ging ich ins Internet und suchte bei Langenscheidt, bei xipolis und schließlich in der Philothek: vergeblich.
Was macht der Klippschüler, wenn er nicht weiterweiß? Er googelt. Und Google erbarmte sich meiner und gab mir Antwort und nannte zwei Dutzend Stellen. Zwei Dutzend, wo sonst die Wörter in Schiffscontainern herangekarrt werden! Ich hatte eine seltene Perle im Universum der Wörter gefunden. Doch während ich eine der Fundstellen öffnete, waren meine Augen zu Herrn Rixens Artikel zurückgekehrt und auf das Wort Umkleide gestoßen. Ich vergaß Googles Funde und fragte mich, ob der Autor den Leser jetzt zur Abwechslung auf die Sprachebene Türken-deutsch entführen wolle. So, als würde einer sagen: „Wir gehen jetzt auf Hof“ oder beim Essen: „Kann ich mal das Brot?“ und das Verb weglässt, als hätte er eine Unterweisung in Orwells Neu-sprech erhalten und wolle jetzt die Tischkonversation updaten. Doch ich möchte hier nicht länger bei den Angstphantasien muslimischer Väter verweilen, sondern mich dem Highlight der Woche zuwenden.
Das Highlight der Woche sind zweifelsohne die Fresskritiken von Herrn Dollase. Seine Worterfindungen „gut gearbeitete Fische“ und „redundanter Geschmack“ haben sich tief in meine Synapsen eingegraben und werden in meinem imaginären Pantheon ausgewählter schöner Begriffe und Wörter einen festen Platz erhalten.
Als ich meiner Frau wieder einmal aus einer seiner Glossen vorlas, sagte sie kurz angebunden: „Reg dich nicht auf, so kann sich der arme Kerl doch wenigstens einmal die Woche satt essen.“
„Ja, aber mit meinem Abo-Geld!“
„Damit kommt er nicht weit.“
„Vergiss nicht, dass ich die Zumutungen schon seit 1971 beziehe.“
Den Ball nahm sie nicht auf, sie war in ihren Mills&Boon-Roman vertieft und träumte wahrscheinlich von dem Piratenkapitän, der auf dem Umschlag abgebildet war, bis sie unvermittelt versetzte: „Vielleicht ist er wie Averroes auf der Suche.“
„Auf welcher Suche?“
„Nach der Essenz.“
„Welcher Essenz? Der der Aromen wie der Chemiker in der fetten Ente?“
„Nein, du Dummkopf, nach der Essenz der Wörter. Vielleicht hat er Husserls Phänomenologie gelesen und ist in einer der Reduktionsebenen steckengeblieben – so, wie die Gruppe im Film „The Cube“, wo nur die Mathematikerin weiß, wie man rausfindet.“
„Aber Husserl ist doch out. Das Zentralkomitee bewilligt kein Papier für einen Nachdruck.“
Inzwischen ist der Ruhm des Gastrokritikers bis in die Rheinprovinz gedrungen und wurde sogar im Regio-TV angemessen gewürdigt. Seitdem wird im hiesigen Freundeskreis gerätselt, ob es sich bei Herrn Dollase, der so gekonnt mit den dafür notwendigen Spezialwerkzeugen die Kochergebnisse besternter Meister auseinandernimmt, um jenen Dollase handelt, der vor Jahrzehnten als Krautrocker für die Band Wallenstein das Piano bearbeitete und dabei den Lambrusco aus 2 1/2-Liter-Flaschen schluckte. Sollte dem so sein, so hat ihm gewiss keine Wahrsagerin aus der Kristallkugel oder den Karten prophezeit, dass er einmal als Fresskritiker zu den Edelfedern Ihres Feuilletons gehören würde. Doch da dieser Satz politisch nicht korrekt ist und überdies den Hautgout von Neid, Missgunst und Gehässigkeit verströmt, bitte ich Sie höflich, ihn aus Ihrem Kurzzeitgedächtnis zu streichen; ich reite eine Volte, würfele sechs Augen und kehre zum Ausgangspunkt zurück: Lieber Herr Rixen, heben sie mein Klippschulunwissen auf Ihr Niveau und mailen sie mir bitte die Bedeutung von polemogen zu! Und vergessen Sie bitte nicht ein cc. (mit einem c. v. des Wortes) an Pippi Langstrumpf, denn sie wurde durch ihre berühmte Frage: „Wer hat nur all die Wörter erfunden?“ zur Mutter der Linguistik und sammelt die schönsten Exemplare noch immer in ihrem Heimatmuseum.
Mit freundlichen Grüßen usw
(Hinweis: kk steht für Karl Korn)
(Juli 2005)

Irgendwann während meiner Schulzeit wurde meine Mutter Mitglied im Deutschen Bücherbund und erhielt seitdem viermal im Jahr per Post einen Katalog mit dem vorhandenen Programm, neuen Buchangeboten sowie einem sogenannten Vorschlagsband – bei dem es sich meiner Erinnerung nach in der Regel um einen dickleibigen Roman handelte. Zunächst ließ sie sich meist den jeweiligen Vorschlagsband zuschicken, und so kam ich zur Lektüre von Steinbeck (Früchte des Zorns, Jenseits von Eden) und Dostojewski (Die Brüder Karamasow, Schuld und Sühne), aber auch zu John Knittel (Via Mala) und James Jones (Verdammt in alle Ewigkeit). Später fragte sie nach meinen Wünschen und bestellte Kunstbücher (z. B. Lizenzausgaben vom Verlag DuMont Schauberg) oder Dünndruckausgaben klassischer (meist französischer oder russischer) Literatur aus dem Winkler-Verlag. Als sie nach 25 Jahren die Mitgliedschaft kündigte, hätte ich erwartet, dass der Bücherbund ihr eine Rückfrage zu den Kündigungsgründen schicken würde. Aber nichts dergleichen geschah. Offenbar hatte der Club an dem einzelnen Kunden kein weiteres Interesse.
Über einen längeren Zeitraum hatte der Buchclub einen Band mit dem Titel „Das imaginäre Museum“ im Programm. Es stammte von André Malraux, der mir als Politiker bekannt war, nicht aber als Schriftsteller. Zu der Zeit war er französischer Kultusminister unter de Gaulle und erregte mit seinen Aktionen viel Aufsehen, auch sein Streit mit Sartre war in Deutschland nicht unbemerkt geblieben. Das Buch „Das imaginäre Museum“ behandelte gemäß der Kurzbeschreibung im Katalog ausschließlich Skulpturen als Objekte einer Weltkunst verschiedener Epochen und Kulturen, und ich habe mich damals nicht weiter damit beschäftigt, aber den Titel im Gedächtnis behalten.
Jahre später begann ich nach dem Besuch einer Kunstausstellung ein Gedankenexperiment mit der Überlegung, welche zwei oder drei Bilder ich aus der eben besuchten Ausstellung mitnehmen würde, wenn ich die freie Wahl hätte, um ein eigenes imaginäres Kunstmuseum europäischer Malerei zu errichten. Da ich regelmäßig Ausstellungen besuchte, wurde die zunächst nur in meinem Kopf existierende Liste mit den „requirierten“ Gemälden immer länger, und ich sah mich genötigt, sie auf Papier zu bringen. Da die entstehende Liste bald einer Struktur bedurfte, beschloss ich für mein imaginäres Museum eine Gliederung in sechs Jahrhunderte (vom 15. bis zum 20.), wobei für ein Jahrhundert jeweils Platz für einhundert Gemälde zur Verfügung gestellt werden sollte. Außerdem sollte pro Maler nur ein Bild gezeigt werden – aber jeweils das beste. Bald stellte sich heraus, dass die Bestückung der noch weitgehend leeren Museumsräume unterschiedlich schwer war. Für das 20. Jahrhundert hatte ich meine hundert Bilder schnell beisammen, und auch für das 16. Jahrhundert benötigte ich wenig Zeit, da ich mich schon ausführlich mit dem Manierismus auseinandergesetzt hatte. Das 17. und das 18. Jahrhundert dagegen bereiteten mir große Schwierigkeiten. Wie sollte ich zum Beispiel aus dem großen Haufen vorzüglicher holländischer Stillleben die wirklich besten herausfiltern? Und mit dem Rokoko hatte ich mich kaum beschäftigt. Außerdem zeigte sich, dass der zweite Grundsatz „Pro Maler nur ein Bild“ nicht einzuhalten war. Zwar gibt es genügend Maler, deren Kunst man meiner Ansicht nach mit einem einzigen Bild überzeugend präsentieren kann (für Picasso z. B. reicht mir „Guernica“, für Matisse „Das rote Zimmer“ und für Max Ernst „Das Auge des Schweigens“). Aber diesen Beispielen stehen Künstler wie Goya oder Tizian oder auch Rubens und Velasquez gegenüber, deren Themenvielfalt und malerische Entwicklung nicht in einem einzigen Bild gebündelt werden können. Zähneknirschend vereinbarte ich daher mit mir selbst einen Kompromiss: Also gut, in Ausnahmefällen zwei, meinetwegen auch drei Beispiele. Vor zehn Jahren hatte ich meine erste Liste (allerdings mit Lücken im 15. und 18. Jahrhundert) zusammengestellt und begann, das nunmehr benötigte Museumsgebäude zu entwerfen. Ich stellte mir für jedes Jahrhundert eine Halle von 100 m Länge und 10 m Breite vor, in denen die Bilder chronologisch gehängt werden sollten, also nicht nach Ländern oder Schulen. Jeweils drei Jahrhunderthallen sollten nebeneinander liegen und dazwischen ein Innenhof von 40 m Breite und 80 m Länge entstehen – für einige ausgewählte Skulpturen, verstreute Sitzplätze, Bäume und ein Café.
Jetzt habe ich mir meine Liste von 1995 erneut angesehen, schüttele beständig den Kopf und stelle mir Fragen wie: Wieso dieses Bild und nicht jenes? Wieso haben ich diesen Maler ausgeschlossen, jenen aber nicht? Dieses imaginäre Museum mit meinen selbst gewählten Regeln zusammenzustellen, ist eine absurde Unternehmung, eine Sisyphos-Arbeit ohne Reliabilität und ohne Validität – letztendlich bleibt nur der eigene Geschmack als Maßstab.
Wie schwierig die Auswahl ist, möchte ich am Beispiel Goyas zeigen. Das Werkverzeichnis von Gassier, Wilson und Lachenal umfasst 1870 Nummern. Auf der Grundlage dieses Werkverzeichnisses und mehrerer Besuche im Prado stellte ich eine Auswahl von zwanzig Gemälden zusammen, die ich durch Streichungen nach und nach auf vier Bilder reduzierte. Übrigblieben „Der Sonnenschirm“, „Die Beerdigung der Sardine“, „Die Gräfin von Chinchon“ und „Der Hund“. Ein Bild musste also noch weichen. Aber welches? Schließlich verzichtete ich auf den Hund, obwohl (oder weil?) es das modernste Bild ist: dieser nach oben gerichtete schwarze Hundekopf mit fragendem Blick vor einem gelben Hintergrund, von dem man nicht weiß, ob es sich um eine Hauswand handeln soll oder eine Staubwolke oder das Nichts. Dabei könnte ich mich in diesem Fall mit meinen eigenen Regeln überlisten. Da das Museum nach Jahrhunderten geordnet ist, könnte ich argumentieren, der „Sonnenschirm“ und „Die Gräfin von Chinchon“ gehörten ins 18. und „Die Beerdigung der Sardine“ und „Der Hund“ ins 19. Jahrhundert. Diesen Präzedenzfall könnten allerdings weitere Künstler einklagen, Bosch z. B. oder Gauguin oder Klimt … Mache ich diese Konzession, wird die endgültige Sammlung womöglich 700 Werke enthalten und bedarf eines Anbaus.
(Im Mai 2005)
